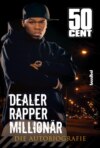Читать книгу: «Krautrock», страница 6
Äußere und innere Emanzipation
Die äußere Emanzipation von angelsächsischer Dominanz bringt eine neue, demokratische Freiheit innerhalb des Gruppengefüges mit sich. Einen Bandleader im herkömmlichen Sinne gibt es nicht mehr, und durch die wachsende Bedeutung der Improvisation verändert sich die Funktion einzelner Instrumente. Die seit der Erfindung des elektromagnetischen Tonabnehmers Anfang der Dreißigerjahre zum Soloinstrument aufgestiegene Gitarre teilt sich ihre prominente Aufgabe nun mit den bisherigen »Sidemen«. Bass- oder Schlagzeugsoli werden frenetisch beklatscht, bei manchem Trommler verschwimmen die Grenzen zwischen Solo und Begleitung vollständig.
Die Instrumente der sogenannten Rhythmusgruppe bestreiten nicht nur lange Solopassagen, sondern übernehmen teilweise auch struktur- und melodietragende Funktionen. Herausragendes Beispiel ist die Bassgitarre bei Kraan, die der Musik wie ein Leadinstrument ihren Stempel aufdrückt: »Die klassische Bassistenrolle hätte mir nicht gelegen«, sagt Hellmut Hattler. »Zwar musste ich am Anfang erst herausfinden, wann ich anfangen und wann ich wieder aufhören musste. Aber ich hatte meinen Spaß daran gefunden und wollte auch auf die Soli nicht mehr verzichten.« Hattler stattet sein Instrument später mit einem Vibratosystem aus und spielt Solo-LPs fast ausschließlich auf dem Bass ein. Der Rollentausch wirkt sich umgekehrt auch auf die Melodieinstrumente aus: Oft bilden Orgel und Gitarre in zerhackten Stakkati das musikalische Fundament, welches, anders als im Free Jazz, stets an einem durchgehenden Rhythmus festhält.
Mit der Aufgabe der traditionellen Rollenverteilung werden auch herkömmliche Spieltechniken über Bord geworfen. Freilich geschieht dies häufig, um ungenügende spielerische Fähigkeiten zu kompensieren. Da jedoch Klangfarbe und Atmosphäre zum vorherrschenden Element in der Musik werden, kommt es auf beeindruckende Fingerfertigkeiten auch gar nicht an – ganz im Gegensatz zum Jazzrock oder dem zur selben Zeit aufkommenden britischen Hard Rock. Vielmehr gilt alles, was neu und ungewohnt ist, zunächst einmal als gut: So lassen sich den Schlagzeugbecken mit einem Geigenbogen neue, fremdartige Klänge entlocken. Gitarrensaiten, per Magnet in Schwingungen versetzt, erzeugen schaurig-schöne, singende Töne, ähnlich denen eines Theremin.
In solchen Klanggefügen büßt der Gesang seine Stellung als melodietragendes und inhaltlich beherrschendes Element ein. Texte werden in einzelne Wortfetzen zerstückelt, die menschliche Stimme nur als zusätzliches Instrument eingesetzt: Flüstern, Schreien, Stöhnen, Sprechen – die Möglichkeiten emotionalen Ausdrucks sind beinahe unerschöpflich. Renate Kaup (Amon Düül II) oder Damo Suzuki (Can) akzentuieren mit ihrem oft auf spontanen Eingebungen beruhenden Vokaleinsatz das Gesamtbild.
Dieses rückt in den Fokus des neuen Denkens. Viele Improvisationen der Sechziger verlieren sich noch in langatmigen Ego-Trips der jeweiligen Solisten, die im Wechsel miteinander über einem vorgegebenen Akkordschema musizieren. Bands wie Can erkennen jedoch, dass nur innerhalb des Gruppengefüges ein neues, gemeinsames Ganzes entstehen kann. Dazu Irmin Schmidt:
»Entscheidend war, dass man weniger als Virtuose und Instrumentalist glänzen wollte, sondern zuhörte, ganz Ohr war, was entstand – um dem, was entstand, möglichst bescheiden zum Blühen zu verhelfen, anstatt als Individuum in Erscheinung zu treten, sodass das Ganze am Ende zu einem Organismus wurde. Im Jazz liefert jeder Einzelne sein Solo ab. Das wollten wir aber nicht. Wir wollten, dass wir vier EIN Komponist werden.«
Rückkehr zur Form:
»Spontankomposition«
Schmidt betont den Unterschied zwischen der Improvisation und der sogenannten Spontankomposition: »Bei der Improvisation gibt es einen vorgegebenen harmonischen Ablauf und vielleicht sogar einen bestimmten Groove, den das Stück erfordert. Der Unterschied ist, dass wir nicht ÜBER Stücke improvisiert haben, sondern spontan Stücke ERFUNDEN haben. Das bedeutet, dass in jedem Moment auch der Wille da war, eine Form zu finden. Wir waren leidenschaftliche Musikerfinder.«
Auch Kraftwerk, NEU! oder Harmonia improvisieren nicht mehr im eigentlichen Sinne, sondern erproben ebenfalls eine Art kollektives Denken. Vorherige Absprachen bleiben auf ein Minimum beschränkt. Es gibt nun keine Solisten mehr, die auf einem sicheren Grundgerüst ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, sondern nur noch die Gruppe. »Wir haben sehr aufeinander gehört und [gemeinsam] ein organisches Gebilde entwickelt«, erklärt Michael Rother, der 1971 »durch Zufall« zu Kraftwerk stößt und danach mit NEU! und Harmonia Zeichen setzt. »In den Sechzigern hatte ich eine Zeit lang noch versucht, die Musik durch immer größere Komplexität aufzuwerten, bis ich das als nicht sehr befriedigenden Weg erkannte. In Zusammenarbeit mit Kraftwerk und den anderen Gruppen und Künstlern ging ich genau den umgekehrten Weg – das heißt, zurück zu ganz einfachen Ausdrucksweisen und Strukturen. EIN Akkord, EINE Harmonie zum Beispiel.« Hierin liegt einer der augenfälligsten Unterschiede zum parallel entstehenden angelsächsischen »Progressive Rock«, der kompositorisch festgelegte, möglichst komplexe Werkteile aneinanderreiht.
Der konsequente Minimalismus des Krautrock gewinnt seinen ästhetischen Wert aus einer praktischen Erkenntnis: In dem Bemühen, die Klischees aus der Rock- und Bluesmusik zu vermeiden, lassen sich alle einzelnen Elemente der Musik nur dann gleichzeitig überschauen, wenn man sie möglichst einfach hält. Can-Bassist Holger Czukay prägt den oft zitierten Ausdruck der »Beschränkung als Mutter der Innovation«. Czukay, der die Proben von Anfang an mit einem Tonbandgerät aufzeichnet, bearbeitet das Material nachträglich mit Hilfe von Klanggeneratoren, Kurzwellenempfängern und anderen elektronischen Geräten.
EXKURS:
Urknall des Krautrock – die Internationalen Essener Songtage 1968
»In dieser Breite und Zusammensetzung gab es vorher nichts.«
– Horst Stein, Mitorganisator der IEST ’68 –
»Es war die Manifestation einer neuen Bewegung.«
– Peter Leopold, Amon Düül II –
Sie gelten als Geburtsstunde des Krautrock: die Internationalen Essener Songtage 1968, das erste große Rockfestival auf europäischem Boden. Für fünf Tage, vom 25. bis 29. September, wird die Stadt im Ruhrpott zum Mekka der weltweiten Popkultur. An acht verschiedenen Orten treten bei insgesamt 43 Veranstaltungen über 200 Musiker und Musikerinnen auf. Viele ausländische Künstler sind zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Das für damalige Verhältnisse unglaubliche Spektakel zieht über 40.000 Besucher an.
Neben Frank Zappa and The Mothers of Invention, Jimi Hendrix, The Fugs oder Pink Floyd bieten die Songtage erstmals auch der neuen deutschen Rockmusik eine Bühne von internationalem Format. Bands wie Amon Düül (sowie die kurz zuvor abgespaltenen Amon Düül II), Guru Guru Groove oder Tangerine Dream werden gleichberechtigt in das Programm eingebunden. Eine einmalige Chance, erinnert sich Peter Leopold: »Mit den deutschen Gruppen allein hättest du nie solche Events durchziehen können. Das war ein sehr guter Gedanke – ist es heute noch, man sollte das wieder aufnehmen. Es ging nicht um Deutschland oder England oder Amerika, sondern nur um gute Musik und gute Bands.«
Tatsächlich geht es noch um weit mehr: Gesellschaftlicher Protest des Anti-Establishments und braves Bürgertum prallen in Essen aufeinander. Somit sind die Essener Songtage auch eine Momentaufnahme der deutschen Gesellschaft im Jahre 1968.
Von der Waldeck nach Essen:
Der Traum vom deutschen Monterey
Die Idee zu den Songtagen hat der 25-jährige Musikjournalist Rolf-Ulrich Kaiser, der später als Musikproduzent und Labelbetreiber zu einer prägenden Figur der Krautrockszene wird. Beim Folk-Festival auf der Burg Waldeck kommt er 1964 erstmals mit der alternativen Musikszene in Berührung und ist fasziniert vom starken gesellschaftlichen Einfluss der Folk-Musik, welchen er bald auch in der neuen Popmusik erkennt.
Kaiser schwebt ein großes Musikspektakel vor, bei dem sich die Jugend-Musikkultur in ihrer gesamten Bandbreite präsentieren kann: ein Festival, das die politischen und gesellschaftlichen Bezüge der zeitgenössischen Musik berücksichtigt, ein unzensiertes Festival, eine demokratische Mitmachveranstaltung. Rolf-Ulrich Kaiser, der (neben Martin Degenhardt) zum künstlerischen Leiter der Songtage bestellt wird, kündigt im Festival-Begleitheft ein »Musikhappening« an, das »bewusstseinserweiternd und bewusstseinserweitert, psychedelisch, andere Erlebniswelten erschließt und somit eher emotional das Erworbene und Gewohnte in Frage stellt.«
Dieser Gedanke entspringt freilich nicht allein der Vorstellungswelt Kaisers. Im Juni 1967 lockt das Monterey Pop Festival an drei Tagen 200.000 Besucher in das kalifornische Städtchen am Pazifik. Eine Pioniertat. Kommuneleben, freie Liebe, Drogenkonsum, Sit-ins – die Befreiungsmechanismen der US-Subkultur werden auch in Deutschland dankbar übernommen. »Er hatte schon so etwas in der Richtung im Kopf«, erinnert sich der Mitorganisator der Essener Songtage und damalige Leiter der Stadtjugendpflege, Horst Stein. »Er wollte Popmusik, aber nicht alleine, sondern auch Protest, aber nicht alleine. Er wollte im Grunde genommen eine möglichst breite Palette zeigen und die ganze Szene damit ein bisschen aus der Schmuddelecke holen.«
Inhaltliche Freiheit und Idealismus:
Die Organisation
Als Träger der Songtage wird eine eigene Arbeitsgemeinschaft des Jugendamtes Essen gegründet, die Kaiser inhaltlich alle Freiheiten lässt. Eine Zensur des Programms findet nicht statt. Es sind ohnehin mehr die praktisch-organisatorischen Fragen, die Probleme bereiten: Ein Musikereignis dieser Dimension stellt in der Bundesrepublik ein Novum dar. Als erste Hürde erweist sich die Finanzierung. Bei Eintrittspreisen von drei bis fünf Mark pro Einzelkonzert müssen die Songtage ordentlich bezuschusst werden. Der begeisterte Kaiser läuft zu Höchstform auf, engagiert immer mehr Gruppen, plant immer mehr Programm. Die Kostenspirale dreht sich mit beängstigender Geschwindigkeit nach oben. Aus geplanten 75.000 werden 100.000 Mark, an anderer Stelle ist sogar die Rede von 300.000. Für die damalige Zeit eine gewaltige Summe.
Kultur-Sponsoring im heutigen Sinne existiert in der Bundesrepublik der späten Sechziger praktisch nicht. Die Lufthansa bietet jedoch an, die Mothers of Invention zum Nulltarif einzufliegen. Allerdings nur die Musiker. Stein: »Den Transport ihres Equipments mussten sie selbst bezahlen. Sie haben ihr ganzes Zeug im Flugzeug mitgebracht, und das war ganz schön viel.«
Trotz des straffen Budgets kursiert bald das Gerücht, die Veranstalter verdienten sich an den Songtagen eine goldene Nase – ein schwerer Vorwurf aus den Reihen der revolutionären Jugendkultur, gegen den sich Stein nachdrücklich zur Wehr setzt: »Diese goldene Nase hätte ich gerne gesehen. Keiner hat irgendetwas bekommen oder Überstunden abgerechnet. Der Einzige, der eine Aufwandsentschädigung erhalten hat, war Rolf-Ulrich Kaiser – für die Telefonkosten.«
Dass ein solches Mammut-Festival möglich wird, liegt – neben dem Organisationstalent Kaisers, der einen guten Kontakt zur amerikanischen Szene pflegt – vor allem am Idealismus der teilnehmenden Musiker: Die meisten Bands verzichten auf ihre Gage. Lediglich die Gäste aus Übersee erhalten eine Unkostenpauschale. »Das Meiste hat Zappa bekommen, aber verdient hat er dabei sicher nichts«, schätzt Stein. Die zehnköpfigen Mothers of Invention führen mit 30.000 Mark die Kostenliste an, The Fugs um Tuli Kupferberg kassieren 6.000 Mark. Daneben spielen Spesen und die Verpflegung der vielen freiwilligen Helfer eine eher untergeordnete Rolle.
Französische Künstler wie Julien Creco oder George Brassens bleiben dem Essener Festival übrigens fern. Die französische Künstlergewerkschaft verfügt kurzerhand: Wer nach Essen fährt und ohne Gage auftritt, wird in Frankreich boykottiert.
»Revolution aus Deutschland«:
Das Programm
Das Programm der Songtage ist sensationell. In der Aula der Pädagogischen Hochschule, der Grugahalle und im großen Saal des Jugendzentrums zeigt sich die gesamte Bandbreite damaliger Subkultur: Psychedelischer Rock, Free Jazz, Folk, linkes Protestlied, Gypsy-Swing, Blues, Kabarett, Multimedia-Shows. Der Mix-Gedanke geht dabei in vollem Umfang auf: Zwischen Alexis Korner, Tim Buckley, Family und Zappa präsentieren sich nicht nur Waldeck-Protestsänger wie Franz-Josef Degenhardt, sondern unter dem Titel »Popmusik aus Deutschland« auch die Bands der deutschen Krautrockszene. »Es gab sicherlich Unterschiede zwischen den englischen und amerikanischen und den deutschen Bands«, erinnert sich Stein. »Im Grunde aber war das Interesse für alle Gruppen wahnsinnig groß.«
Dies gilt auch für die Medien. In ihrer Ausgabe vom 28. September 1968 jubelt die Westdeutsche Allgemeine Zeitung: »Das, was bei den Essener Songtagen in der Veranstaltung ›Deutschland erwacht‹ geboten wurde, stellt zweifellos die Revolution in der Popmusik dar. Und diesmal kommt – o Wunder – die Revolution aus Deutschland.«
Manifestation einer Gegenbewegung
»Wir sind elf Erwachsene und zwei Kinder und haben uns entschlossen, alles gemeinsam zu machen, auch die Musik!«
– Amon Düül in ihrer handgeschriebenen
Bewerbung für die Essener Songtage –
Die Essener Songtage sind so etwas wie die Love-Parade für die auslaufenden Sechziger, ein Coming-out der Untergrund-Kultur, deren Musik Kaiser als Ausdruck einer sich verändernden Welt betrachtet: »Wir wollen zeigen, dass es gerade in der Musik, die jahrelang vor allem in der Bundesrepublik als eine Musik für Minderbemittelte galt, wesentliche Veränderungen gegeben hat«, zitiert ihn Norbert Kozicki in seinem Buch Aufbruch im Revier. Zu diesen gehören »eine neue Form des Arrangements, ein Experimentieren mit musikalischem Material und vor allem ein Text, der nicht Klischees versammelt, sondern die Welt beschreibt, wie sie ist, oder wie man sie verändern könnte«.
Im großen Rahmen wird der musikalische Aufbruch nun öffentlich beschworen, um das neue Lebensgefühl einer rebellischen Generation ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Beim Abschluss-Happening in der Grugahalle (Titel: »Ein Augen- und Ohrenflug zum letzten Himmel«), für welches eigens die Stuhlreihen abmontiert werden, ist es dem Besucher daher ausdrücklich gestattet, »zu singen, zu schreien, zu tanzen oder ein x-beliebiges Instrument zu spielen«.
Nicht alle sind überzeugt vom subkulturellen Charakter der kostspieligen Großveranstaltung. »Da gab es die ganz Scharfen, die sagten, ›jetzt hat uns das Establishment umklammert‹«, erzählt Horst Stein. »Weil ja der Hauptveranstalter das Jugendamt, also die Stadt Essen war. Für manche war das ein harter Brocken.«
Die fünf Tage werden trotzdem für alle Beteiligten zu einem Abenteuer. Erstmals bietet sich in Essen das typische Bild eines Konzert-Camps. »Damit die nicht alle irgendwo pennen« (Stein), werden Zeltlager eingerichtet. Um die Sicherheit der Festivalbesucher machen sich die Organisatoren jedoch Sorgen. Eine Betreuung durch professionelle private Sicherheitsdienste, wie sie bei Massenveranstaltungen heute die Regel ist, liegt noch in ferner Zukunft.
Bereits am ersten Abend kursieren Gerüchte, die Rocky-Bande aus Essen-Steele plane, das »Gammlerlager« am Baldeneysee zu überfallen. Zum Sturm auf das Zeltlager kommt es zwar nicht, jedoch zu einer Begegnung von Moped-Rockern und Hippies im Jugendzentrum, in deren Verlauf sich beide Seiten näherkommen: Verblüfft stellt man fest, dass man »die gleichen Bürger« verachtet. »Es ist schon erstaunlich, dass während der gesamten Songtage nichts Ernsthaftes passiert ist«, sagt Horst Stein heute erleichtert. »Es ist alles so friedlich verlaufen, dass sich die Presse ein paar Geschichten aus den Fingern saugen musste.«
Neugier, Vorurteile, Engagement:
Essen und das Festival
Ein Teil der Bürgerschaft indes gerät angesichts der einfallenden Massen langhaariger Jugendlicher in helle Aufruhr. Essen hat damals rund 620.000 Einwohner, davon sind etwa ein knappes Drittel unter 21 Jahre alt. Das Festival trifft die verschlafene Stadt »wie eine Atombombe«, so Bernd Witthüser, Geschäftsführer der Songtage, der als Protestsänger auch selbst dort auftritt. Staunend beobachtet man das bunte Treiben. Die WAZ berichtet am 25. September:
»Karten für die Songtage verkauften gestern auf dem Burgplatz echte und zurechtgemachte Hippies. Eigentlich sollte ein gepfeffertes Happening daraus werden. Doch der Regen war dagegen. Die vermummten Sängerknaben und ihre kessen Begleiterinnen ließen die Lautsprecher verschwinden, verzichteten auf die geplante Besteigung Wilhelms, des Kaisers, und ließen das mitgebrachte Klo auf der Kettwiger allein. So standen sie untätig im Regen: malerische Männer und Mädchen zwischen bemalten Autos. Statt einer lustigen Schau gab es ein paar Schaulustige.«
Die einen freuen sich über internationale Aufmerksamkeit, die anderen ziehen gegen das vermeintliche »Gammlertreffen« zu Felde. Insbesondere die riesige Fördersumme – zumal für ein Festival der Jugendkultur – löst vehemente öffentliche Diskussionen aus. Horst Stein: »Die Meinung der Öffentlichkeit war gespalten. Die Bevölkerung hat ja nur das Äußere mitgekriegt. Die waren zunächst völlig erschlagen von den vielen Hippie-Gestalten in der Stadt. Man war ganz erstaunt, dass Frank Zappa fragte, ob es hier auch Duschen gebe.« Die Vorurteile der Bevölkerung bekommt Zappa am eigenen Leib zu spüren: Im strömenden Regen versuchen er und seine Begleiterin, ein Taxi zu rufen. Die ersten sieben Fahrer winken nur ab und lassen den zotteligen Rockstar im Regen stehen.
Auf der anderen Seite können sich aber auch viele Bürger für den internationalen Gedanken des Festivals begeistern. Ehrenamtliche Helferinnen wie Zappas Begleiterin, zu erkennen an einer kleinen Gitarren-Anstecknadel am Revers, unterstützen die Songtage tatkräftig. »Die Hostessen dieses jugendlichen Musikfestivals sind so etwas wie ein Stück Visitenkarte von Essen«, verkündet die WAZ stolz. Die »Verbindungsleute in unserer Stadt« erwartet gleich ein ganzes Aufgabenfeld: Künstler müssen vom Flughafen abgeholt und untergebracht, Ersatzteile für Instrumente besorgt werden. Fernsehteams, Rundfunk- und Zeitungsjournalisten verlassen sich auf die Sprachkenntnisse der »Studentinnen, Schülerinnen, Auslandskorrespondentinnen, Stenotypistinnen, Hausfrauen, Sprechstundenhilfen«, die außer freier Kost und Eintritt zu den Konzerten nur ein kleines Taschengeld erhalten. Dabeisein, Mitmachen ist alles.
Die Zeltlager liefern derweil Stoff für wilde Fantasien. Öffentlichkeit und Presse vermuten Sexorgien und Drogenexzesse. »Sie haben extra ein paar Leute rausgeschickt und waren dann ganz erstaunt, dass alles ganz brav und lieb war«, sagt Horst Stein. Ein mutiger Anwohner, anfangs noch besorgt um den Bestand seines Vorgartens, mischt sich schließlich unter die Festivalbesucher. »Der ist praktisch jeden Tag da gewesen und hat einen glühenden Brief geschrieben, wie dufte er das fand, dass die Leute am Lagerfeuer saßen und ganz bescheiden ihr Brot und ihren Käse gegessen haben.«
Eine »pop-musikalische Agitationsveranstaltung«
Veranstaltungen wie »Protest International« und Protestaktionen der APO sollen die IEST’68 zu einer »pop-musikalischen Agitationsveranstaltung« (Kaiser) machen. Transparente und Spruchbänder fordern allerorten »Amis raus aus Vietnam« oder »Freiheit für Cohn-Bendit« – nebst Spendensammlung für die Verteidigung des Frankfurter Studentenführers. Die neue deutsche Protestkultur wird manch internationalem Gast zu viel. So beklagt Frank Zappa später, dass zu viele Konzerte in politische Diskussionen ausgeartet seien.
Wilhelm Nieswandt, damals Oberbürgermeister der Stadt Essen, nimmt den politischen Aspekt zunächst nicht sonderlich ernst. Als er die teilnehmenden Musiker am 26. September zur geschlossenen Gesellschaft in den städtischen Saalbau lädt, kommt es zum Eklat: »Das Establishment ließ bitten«, formuliert Horst Stein den Ärger der Jugend, die immer noch Profitgier wittert. »Da hieß es auf einmal, ›die werden empfangen, und wir, die Zuschauer, nicht. Schließlich wurde der Saal gestürmt. Die Kuchentheke wurde geplündert, Bierdeckel flogen durch die Luft.«
Der anfangs wohlwollende Tenor in den Zeitungen schlägt nach diesem Ereignis um. Die WAZ berichtet großformatig über den Skandal, der von vielen Bürgern heimlich herbeigesehnt wird. Dies wollen die Festivalbesucher mit einem Protestmarsch zum Redaktionssitz erwidern. Stein wird zum Polizeipräsidenten gebeten:
»Die Polizei wollte alles abriegeln, Zäune aufstellen und Wasserwerfer einsetzen. Ich wurde gefragt, was ich darüber dachte. Da wir am nächsten Tag noch ein Konzert in der Grugahalle hatten, schlug ich vor, mit dem Verfasser des betreffenden Artikels vor Beginn eine Podiumsdiskussion zu veranstalten. Der Reporter hatte Angst und verlangte Polizeischutz.«
Die Handvoll Demonstranten, die schließlich doch noch vor den verschlossenen Toren der WAZ aufmarschieren, lässt der Verlag in einem eigens bestellten Bus zurück zum Festival kutschieren – versehen mit Freikarten. Im Saal wird eine Dreiviertelstunde lang diskutiert, dann ertönen die ersten Rufe »Aufhören! Anfangen!« Der Fall scheint erledigt. Doch die Gemüter sind erhitzt, und die kurzzeitig aufgeweichten Fronten zwischen Jugendlichen und bürgerlichem Lager verhärten sich weiter.
Später heißt es in einer erzwungenen Gegendarstellung zum Skandal-Artikel: »Auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung betreibt seit neuestem mit Macht die famose Schädlingsbekämpfung. Sie präsentiert dem kerngesunden Volksempfinden die Songtage als ›Revoluzzerfestival‹ von langsamdenkenden, stunksüchtigen Freibiertrinkern, Hinternkneifern, Busenfummlern, Rabauken, die mit Behagen in reinen Sauereien in der Kloake herumrühren.«