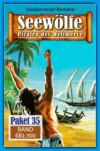Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 2
2.
Nach acht Tagen fanden sich Malindi und Chandra wieder in der baufälligen Hütte ein.
Malindis Haar war zwar noch nicht so lang wie früher, aber es waren schon schwarze Stoppeln, die jetzt seinen Kopf bedeckten. Von der tätowierten Karte war auf den ersten Blick nichts mehr zu sehen.
Über dem Fluß hingen wieder riesige Schwärme von Stechmücken, und die Luft war heiß und stickig.
„Das sieht sehr gut aus“, sagte der große Subedar und betrachtete aufmerksam Malindis Kopf. „Die Haare sind so stark nachgewachsen, daß man nichts mehr erkennen kann. Damit steht eurer Abreise nichts mehr im Weg. Wir werden jetzt die allerletzten Kleinigkeiten besprechen, und dann nehmt ihr das Boot. Bis ihr drüben seid, vergehen nochmals etliche Tage. Niemand wird dann noch etwas auf deinem Kopf bemerken. Sobald ihr nicht mehr weiter über euren Weg im klaren seid, wird Chandra dir den Kopf rasieren, und danach trägst du einen Turban. Ich hoffe aber, daß es nicht nötig sein wird.“
Zuerst brachte er das Kästchen mit der Wundernadel und dem dazugehörigen Brett, in dem der kleine Nagel steckte. Fast feierlich überreichte er es den beiden.
„Ihr wißt ja jetzt, wie es zu handhaben ist. In dem Boot ist eine kleine Vertiefung auf einer der Duchten. Dort stellt ihr es hinein. Habt ihr das verstanden?“
„Ja, großer Subedar.“
Malindi beschlich wieder dieses unangenehme Gefühl von jemandem beobachtet zu werden, den man selbst nicht sehen konnte, der aber doch über alles Bescheid wußte.
Die Anhänger der religiösen und fanatischen Sekte verließen die Hütte und führten die beiden Männer zu dem Boot.
Sie haben wirklich keine Kosten gescheut, dachte Malindi, als er das an einem winzigen Holzsteg vertäute Boot sah.
Es hatte zwei Riemen und einen kleinen Mast mit einem Segel, und es ähnelte einem der üblichen Fischerboote. Es war nur ein wenig größer und geräumiger. Ein Mann konnte in dem Boot bequem schlafen, wenn er müde war, während der andere dann an der Pinne saß. So konnten sie sich gegenseitig abwechseln.
Die beiden staunten über die Vorräte, die sich in dem Boot befanden.
Der Subedar schlug ein Stück Segeltuch zur Seite und deutete stumm mit der Hand unter die vordere Ducht, unter die ein länglicher, hölzerner Kasten eingelassen war. Der Kasten war mehrmals unterteilt und ließ sich zusätzlich mit einem Deckel verschließen. Alles war vor eindringendem Seewasser geschützt.
In dem einen Kasten befand sich als Notproviant getrockneter Fisch, daneben lagen Angelgeräte und ein Netz, wie es die Fischer vor der Küste verwendeten. Ein Kasten war voller Bananen, der andere bis obenhin mit großen Melonen gefüllt. Zwei Fässer mit Trinkwasser befanden sich im nächsten, und im anderen war Reis.
Der Subedar und seine Anhänger hatten auch Holzkohle und die nötigen Utensilien, um ein Feuer zu entfachen, nicht vergessen. Es war wirklich an alles gedacht worden, was für eine längere Reise erforderlich und lebensnotwendig war.
Zum Abschluß erhielt jeder vom großen Subedar noch eine Goldmünze.
„Das ist für den Fall größter Not, oder wenn ihr in eine sehr heikle Situation geraten solltet“, sagte er. „Versteckt es gut, und zeigt es nicht herum. Der große Geist wird über euch wachen. Wir werden euch sehnsüchtig erwarten. Ich bin sicher, daß ihr es schafft, das größte aller Heiligtümer zu uns zu bringen.“
„Wir schaffen es“, sagte Chandra zuversichtlich.
Malindi nickte aufgeregt, er konnte nichts sagen und starrte nur immer bewundernd auf das Boot und seinen Inhalt.
„Dann kann eure Reise jetzt beginnen. Habt ihr auch die Messer?“
Die Messer hatten sie – scharfgeschliffene schmale Dolche, die sie immer bei sich trugen.
Der Subedar und seine fanatischen Anhänger entließen sie mit allen guten Wünschen.
Die beiden nahmen in dem Boot Platz, verneigten sich nach allen Seiten und begannen dann zu pullen. Das Segel konnten sie erst dann setzen, wenn sie aus dem schmalen Nebenarm heraus waren. Hier ging nicht der geringste Lufthauch.
„Bringt die heilige Reliquie!“ rief der Subedar ihnen nach. „Und bringt sie bald! Wir warten auf euch!“
„Wir bringen sie!“ rief Malindi heiser. „Und wenn es unser Leben kosten sollte, wir bringen sie!“
Aber seine Worte waren nur ein bloßes Lippenbekenntnis. Wenn er den Weisheitszahn Buddhas erst einmal hatte, dann würden die anderen Männer nie wieder etwas von ihm hören. Dieser Zahn würde ihm Reichtum, Glückseligkeit und ewiges Leben bescheren. Er schauderte bei dem bloßen Gedanken daran und spürte, wie es ihn heiß und kalt überlief.
Hinter ihnen versank die morastige und sumpfige Landschaft mit ihren Mückenschwärmen und dem Geruch nach fauligem Wasser. Im Schlamm stand ein magerer Wasserbüffel, der ihnen nachsah.
Das fanatische Geschrei achteraus verklang langsam. Jetzt hörten sie nur noch das Schwirren der Mücken und Stechfliegen und das gräßliche Summen, wenn sie sich näherten.
Es war so heiß, daß der Sumpf längst hätte ausgetrocknet sein müssen. Gnadenlos brannte die Sonne von einem milchig-blauen Himmel herunter.
Das sumpfige Wasser hatte die Farbe von Gold und Silber, und es reflektierte die Sonnenstrahlen so stark, daß sie nur eine unbestimmte, glitzernde Fläche sahen.
Eine knappe halbe Stunde pullten sie angestrengt und schweigend. Der Schweiß lief ihnen in Bächen über die Gesichter, aber es half nicht, ihn abzuwischen.
Hin und wieder blickte Malindi auf die Ausbuchtung in der einen Ducht, wo die Wundernadel leicht zitterte. Er wandte den Blick wieder ab und pullte verdrossen weiter. Es paßte ihm nicht, daß in dieser Nadel magische Kräfte steckten und ihn jemand beobachten konnte. Aber er ließ sich nichts anmerken.
Der große Subedar sollte nicht mißtrauisch werden.
Nach einer Ewigkeit, wobei ihre Körper nur so trieften, hatten sie es endlich geschafft und den stickigen Flußnebenarm verlassen.
Sie blickten auf den Golf von Mannar und atmeten erleichtert auf.
Hier war alles ganz anders. Die Luft roch frisch nach Salzwasser, und einen laue Brise, schlug ihnen in die Gesichter. Gegen das Brackwasser war es hier im Golf herrlich erfrischend.
Sie zogen die Riemen ein und ließen sich ein paar Augenblicke treiben, bis der Schweiß auf ihren Körpern verdunstete und sie freier atmen konnten.
„Jetzt können wir endlich das Segel setzen“, sagte Malindi, froh drüber, nicht mehr pullen zu müssen und auch die lästigen Stechfliegen hinter sich zu haben. „Ich denke, es wird eine prächtige Überfahrt.“
Chandra Muzaffar reckte sich. Sein Blick fiel auf die Nadel, und er verneigte sich leicht vor ihr.
„Das Auge Subedars wird auch weiter über uns wachen“, sagte er feierlich. „Ohne die geheimnisvollen Kräfte würden wir es allein nicht schaffen.“
„Wie lange werden wir bis zur Küste brauchen?“
„Bei gutem Wind etwa zwei bis drei Tage. Vielleicht werden es auch vier Tage. Die längste Strecke ist der Küstenabschnitt bis Negombo.“
Malindis Blick fiel wieder auf die Nadel. „Ob der große Subedar auch unsere Worte hören kann?“
„Natürlich kann er das“, sagte Chandra überzeugt. „Er kann uns sehen und jedes unserer Worte hören. Manchmal glaube ich, daß er auch unsere Gedanken lesen kann.“
Er sah nicht, wie Malindi heftig schluckte.
Nein, das kann nicht wahr sein, überlegte er. Wenn der große Subedar Gedanken erfassen konnte, dann hätte er ihn wohl nicht auf die Reise geschickt und sich der ganzen Mühen unterzogen. Der Subedar hätte dann ja wissen müssen, daß er, Malindi, für diese Aufgabe unbrauchbar war, weil er den Weisheitszahn für sich behalten wollte.
Zum ersten Male kamen ihm Zweifel an den Fähigkeiten des Subedar. Vielleicht war er gar nicht so groß, wie er immer vorgab? Vielleicht konnte er sie nicht mal sehen und gab das nur vor, um sie einzuschüchtern und zum Gehorsam zu zwingen.
„Warum grinst du so?“ fragte Chandra.
„Ich bin froh, daß das Abenteuer beginnt und wir beweisen können, was in uns steckt, und ich bin froh darüber, daß wir das Meer erreicht haben und eine kühle Brise unsere Körper kühlt.“
„Ja, darüber bin ich auch froh. Wir werden wie Helden gefeiert werden, sobald wir mit dem Zahn des großen Erleuchteten zurückkehren. Jetzt aber sollten wir den Mast aufrichten und das Segel setzen.“
Sie trieben dicht unter der Küste. Die Sonne stand fast im Zenit, und Chandra beugte sich über die Nadel und die geheimnisvollen Zeichen auf dem Brettchen, die jetzt, da er sie kannte, längst nicht mehr so geheimnisvoll waren.
Die zitternde Nadel gab ihm die beruhigende Gewißheit, daß alles in Ordnung war und der Subedar über sie wachte. Sie zeigte mit ihrer bläulichen Spitze nach Norden und blieb immer auf diesen Punkt ausgerichtet, während das Boot sich um die Nadel bewegte. Es war faszinierend und einfach unglaublich. Ständig schien einer der Götter über die Nadel zu wachen.
Der Mast war schnell aufgerichtet und das Segel gesetzt. Es war nur ein kleines Mattensegel, aber der Wind blähte es und schob das Boot ziemlich rasch über das Wasser.
Malindi setzte sich an die Pinne und bewegte das Ruder so, bis sie genau nach Osten segelten. Zitternd zeigte die Nadel nach Norden. Es war ganz einfach, das Boot nach ihr auszurichten, sobald man erst ein wenig Übung darin hatte.
Chandra nahm sein Messer und zerteilte damit eine der großen Wassermelonen. Er schnitt sie in halbe Scheiben und reichte eine davon Malindi.
Das Fruchtfleisch war rosarot und sehr saftig, und es löschte hervorragend den Durst.
Von jetzt an ging alles spielend leicht, und sie hatten nichts weiter zu tun, als sich alle paar Stunden an der Pinne abzulösen.
Schon nach kurzer Zeit versank der Küstenstrich hinter ihnen und wurde zu einem dunstigen Gebilde, das sie nach einer weiteren halben Stunde aus den Augen verloren.
„Bis hierher fahren die Fischer immer hinaus“, sagte Chandra. „Ich glaube, soweit, wie wir jetzt draußen sind, ist noch kein Fischer jemals hinausgefahren.“
„Bestimmt nicht. Ich war auch noch nie soweit draußen, aber das ist ja erst der Anfang. Wir müssen noch viel weiter hinaus.“
Nach einer Weile wurde allen beiden etwas unbehaglich zumute. Nirgendwo war mehr Land zu sehen. Sie bewegten sich fast lautlos auf einer riesigen Fläche, die scheinbar keinen Anfang und kein Ende hatte.
„Keine Angst“, sagte Malindi und gab sich etwas überlegen. „Wir schaffen es schon. Es ist nur etwas ungewohnt, und wir müssen beten, daß kein Sturm losbricht.“
Weil sie alle beide Angst hatten, flehten sie die Götter an, ihnen keinen Sturm zu schicken.
Die Götter erhörten ihre Gebete jedoch nicht, und auch der große Subedar schien die Kontrolle über sie verloren zu haben.
Am späten Nachmittag jagten dunkle Wolkenbänke heran, die rasch größer wurden und immer stärker aufquollen. Sie ballten sich zusammen, bis sich der Himmel verfinsterte.
„Das ist der Kal-baishakhi“, flüsterte Chandra. „Der Gewittersturm, den wir schon vor ein paar Tagen erlebt haben. Er hat sich verspätet, wie er das oft tut.“
Malindi nickte nur und blickte in den finsteren Himmel. Dort, wo Himmel und Wasser sich scheinbar berührten, war alles schwarz, und man konnte oben und unten nicht mehr unterscheiden.
Überall sah es jetzt so aus. Auch der Wind flaute merklich ab, um neue Kräfte zu sammeln.
Sie kannten diesen Gewittersturm, der mit verheerender Gewalt über das Land und Meer raste. Er fegte auch durch die Sümpfe und knickte Bäume und Sträucher, und er wühlte im Sumpf, den er zu großen Blasen aufwarf, bis er zu kochen schien.
Nach einer Weile war es totenstill um sie herum geworden. Das Meer war dunkel, tief und ruhig wie schwarzes Glas, durch das man nicht hindurchsehen kann. Das Segel hing schlaff vom Mast, und die ganze Welt hielt den Atem an.
„Wir sollten das Segel wegnehmen“, sagte Malindi heiser. „Wenn der Wind einfällt, kann er es zerfetzen. Dann sind wir hilflos.“
In aller Eile holten sie das Segel ein und sahen nach, ob auch die eingebauten Holzkammern dicht waren.
„Das Auge Subedars ruht nicht mehr wohlgefällig auf uns“, sagte Chandra verzweifelt. „Was haben wir falsch gemacht?“
Malindi dachte an seine bösen Gedanken und wurde erneut von Zweifeln gemartert. Es konnte sein, daß der Geist der Nadel sie nur auf die Probe stellen wollte. Es konnte aber auch sein, daß er etwas gemerkt hatte und jetzt böse wurde.
Inzwischen hatte sich der Himmel noch weiter verfinstert. Es war jetzt so dunkel wie bei der kurzen Dämmerung. Auch das Meer hatte die gleiche, unheimliche Farbe angenommen.
Da sahen sie, wie der dunkle Himmel sich spaltete. Er zeriß übergangslos in zwei riesige Teile.
Ein gewaltiger Blitz hieb ins Meer. Bevor er verschwand, verästelte er sich wie ein Baum. Ein gewaltiges Donnergrollen war zu hören. Es ertönte von überallher und brüllte in ihren Ohren, und es schien kein Ende mehr zu nehmen. Auch roch die Luft plötzlich so ganz anders.
Die beiden zuckten zusammen und kauerten sich zwischen den Duchten nieder. Angstvoll starrten sie auf das sich ankündigende Unwetter.
„Hilf uns!“ flehte Malindi.
Er blickte auf die Nadel und zuckte abermals zusammen, als sie immer stärker zu zittern begann. Als wieder ein Blitz niederfuhr und der Donner in ihren Ohren wild und tosend rumorte, drehte sich die Nadel wie verrückt im Kreis und fand nur sehr schwer in ihre übliche Lage zurück.
Über das blanke Meer fuhr ein Lufthauch, der es nervös kräuselte. Winzige Trichter erschienen im Wasser und drehten sich rotierend um ihre eigene Achse. Dem Lufthauch folgte ein wilder Atem, der wütend über die gekräuselte Oberfläche blies und sie weiter aufwühlte.
Nach dem dritten Blitz mit seinem ohrenbetäubenden Krachen und Donnern begann es über der See zu rauschen.
Eine Wasserwand rückte auf sie zu wie eine dunkelgraue Mauer, die sich aus dem Meer erhob.
Der Regen prasselte nur so nieder. Wind fuhr in ihn hinein und trieb ihn fast waagerecht über das Wasser. Der Regen tat weh, obwohl er lauwarm war. Er bohrte sich scharf in die Haut und peitschte sie wild.
Chandra und Malindi lagen jetzt zusammengekauert unter den Duchten und wagten nicht, sich zu rühren.
Der Regen rann über ihre Körper und sammelte sich im Boot. Es schien kein Ende mehr zu nehmen.
Noch schärfer wurde der Wind. Er fuhr mit tausend Armen über das Wasser, das in immer stärkere Bewegung geriet und sich zu hohen Wellen auftürmte. Das Boot begann wild zu schaukeln.
Die beiden Inder ließen alles über sich ergehen. Sie hatten keinerlei Erfahrung auf See und wußten nicht, wie sie sich verhalten sollten.
An Land wären sie einfach in die nächste Hütte gerannt, um sich darin zu verkriechen. Hier konnten sie aber nur kauern und warten, bis alles vorbei war.
Das Boot schlingerte jetzt so wild, daß sie sich verzweifelt an die Duchten krallen mußten. Es legte sich weit über, und jedesmal schoß ein dicker Wasserstrahl hinein. Schon nach kurzer Zeit schwamm die kleine Gräting auf, weil sich unter ihr ein kleiner See gebildet hatte.
Sie merkten nicht, daß sie laut brüllten und heulten. Sie flehten alle Götter an, und sie schwiegen erst dann entsetzt, als ein unglaublich harter Schlag das Boot erschütterte und halb auf die Seite warf.
Da nahm Malindi an, sein und Chandras letztes Stündlein habe geschlagen.
Das Boot torkelte hilflos durch die See, gepeitscht vom Wind und vom fauchenden Regen, hochgeworfen von den sich auftürmenden Wogen und wieder in tiefe Wellentäler zurückgeschleudert. Jedesmal krachte und knackte es, als würde das Boot sich auflösen.
Sie scheuerten sich die Hände wund, ihre Knie bluteten, und mehr als einmal schluckten sie salziges Wasser, das im Hals brannte und Übelkeit erzeugte.
Stundenlang ging das so. Sie hoben aus lauter Angst nicht mal die Köpfe. Sie waren fertig und erledigt und fest davon überzeugt, jeden Augenblick sterben zu müssen.
Nach einer Weile hob Malindi vorsichtig den Kopf. Chandra starrte ihn aus großen, entsetzten Augen an. Das fürchterliche Tosen hatte aufgehört, und das Rauschen war verklungen.
Langsam erhoben sie sich und sahen sich ungläubig um.
Ganz hinten an der Kimm schien wieder die Sonne durch die sich langsam verziehenden Wolkenbänke. Es regnete nicht mehr, nur die See war noch aufgewühlt und schaukelte das Boot hin und her. Die riesige Wolkenwand zog mit ihren Wassermassen und den fürchterlichen Blitzen weiter.
„Wischnu hat uns errettet“, sagte Chandra atemlos. „Wir haben es überlebt.“
„Ja, wir haben …“ Malindi brach ab und starrte entsetzt auf die Ausbuchtung in der Ducht, wo das Auge Subedars gewacht hatte.
Jetzt war die magische Nadel mit dem Brettchen verschwunden und die Ausbuchtung war voller Wasser.
„Oh, großer Geist!“ rief er aus. „Die magische Nadel …“
„Sie ist weg!“ schrie Chandra. „Das Meer hat sie geholt! Jetzt sind wir verloren!“
Das verlorengegangene Auge Subedars war ein herber Verlust für sie, den selbst Malindi fürchtete. Aber irgendeine ferne Stimme in ihm frohlockte auch. Sie hatten jetzt keinen Aufpasser mehr, und es hatte sich gezeigt, daß auch das magische Auge der Götter verletzlich war und nicht die Kraft hatte, den wütenden Elementen zu trotzen.
Sie standen bis zu den Knien im Wasser und blickten sich ratlos an.
Ringsum war nichts als die gigantische Wasserfläche ohne Land, eine Wüste, die lebte und atmete, wenn sie sich hob und senkte.
„Wir müssen nach Osten segeln“, sagte Malindi. Er versuchte, sich am Stand der Sonne zu orientieren, aber es fiel ihm schwer. „Weißt du die Richtung genau?“
„Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Sonne hat mich getäuscht, als sie verschwand.“
Die setzten wieder das Segel und sahen nach, ob ihr Proviant das Unwetter heil überstanden hatte.
Die Melonen hatten ein paar Druckstellen, aber sonst schien alles in Ordnung zu sein.
Das Boot lief jetzt nur ganz langsam und behäbig. In jedem Wellental schlug wieder Spritzwasser hinein.
Chandra nahm eine halbe Kokosnußschale und reichte eine andere Malindi. Damit östen sie das Wasser aus, und es dauerte eine Ewigkeit, bis es wieder da war, wo es hingehörte.
Dabei entdeckte Chandra das Brettchen. Es hatte sich unter Wasser in der Gräting verklemmt und war dort verkeilt. Mit einem glücklichen Lächeln zeigte er es Malindi.
„Das Brettchen nutzt uns nichts“, erklärte Malindi Rama fast verächtlich. „Ohne die magische Nadel ist es nur ein wertloses Stückchen Holz und nichts weiter. Wir können es drehen, wie wir wollen, es wird uns keine Richtung anzeigen oder immer die, die wir gerade haben wollen. Wirf es über Bord.“
„Nein, das werde ich nicht tun. Wir behalten es, auch wenn es ohne den Geist wertlos geworden ist.“
Chandra Muzaffar legte das Brettchen wieder in den ausgehöhlten Teil der Ducht zurück.
Sie östen weiter, bis auch das letzte Wasser aus dem Boot war. Als sie die Gräting wieder einsetzten, sah Malindi es an einer Stelle über der Plicht fahl glänzen und bückte sich.
Das Auge des Subedar sah ihn an mit seinem silbrigen Schimmer. Es lag ganz ruhig da, ohne sich zu bewegen – so, als sei es tot und für alle Zeiten erloschen.
Malindi blickte es unauffällig an, um nicht Chandras Aufmerksamkeit zu erregen. Wie unabsichtlich stellte er den Fuß über die Nadel und mühte sich mit der Gräting ab.
Wenn das Auge Subedars da liegen bleibt, dachte er, bin ich den Spion endlich los, der uns immer belauert. Ich kann es ja einfach übersehen haben, und solange die magische Nadel nicht in ihrem Brett auf dem. Nagel sitzt, ist sie kraftlos und hat anscheinend keinerlei Einfluß. Dann kann mich auch keiner mehr beobachten.
Aber das Auge Subedars war unberechenbar und tückisch. Er rutschte auf dem glatten Teil der Gräting ab und schrie laut auf, als etwas Spitzes in seinen Fuß drang. Er hob das Bein hoch und sah einen Blutstropfen, der herablief.
Die magische Nadel hatte ihn gestochen, der Geist, der in ihr wirkte, ihn mahnend daran erinnert, nicht leichtfertig zu sein.
„Was hast du denn?“ fragte Chandra, der gerade die Pinne übernehmen wollte. „Laß mal sehen.“
Er fand natürlich die Nadel und klatschte laut in die Hände, ohne sich um die kleine Wunde Malindis zu kümmern.
„Ich wußte es!“ rief er erfreut. „Ich habe gewußt, daß das Auge über uns wacht. Es hat uns geholfen, und es wird uns wieder den richtigen Weg weisen.“
Wie ein Heiligtum nahm er die Nadel und setzte sie wieder auf die alte Stelle zurück. Kaum berührte sie den Nagel, da begann sie auch schon zu zittern und zu kreisen, bis sie wieder auf den alten Punkt wies, wo sich das Zentrum der unbekannten Macht befand.
Jetzt war es nur noch ein Kinderspiel, den Kurs auszurichten und weiter nach Osten zu segeln.
Sie segelten in die Nacht hinein. Der Himmel war voller Sterne wie aufgezogene Perlenschnüre, und auch der Mond schien hell und silbern auf das Wasser.
In seinem silbrigen Schein schien die Spitze der Nadel zu glühen und zu blinken und wies ihnen auch weiterhin den Weg.
Sie aßen etwas, tranken dazu das mitgenommene Wasser und starrten schweigend über die Unendlichkeit des Meeres. Irgendwo, noch weit vor ihnen, mußte Ceylon liegen, die Perle Indiens, das Juwel des Ostens, wie es die Araber nannten.
Von den Aufregungen des Tages müde geworden, suchte sich Chandra ein Plätzchen zum Schlafen unter der vorderen Ducht, während Malindi an der Pinne hockte und finster in die Nacht starrte.
Der Subedar oder sein Geist war wieder bei ihm, und er war auch nicht loszuwerden. Malindi fragte sich, was wohl geschehen würde, wenn er das Brettchen in die Hand nahm und ins Wasser warf. Würden die Geister wieder an die Oberfläche zurückkehren und Rache an ihm nehmen? Oder würden sie ganz still und friedlich in dieser unauslotbaren Tiefe für alle Zeiten versinken?
Er wußte es nicht, und als er einmal die Hand ausstreckte, da war ihm, als tauche der große Subedar mit seinem weißen Bart aus der See auf und schüttele drohend den Kopf.
Sofort zog er die Hand zurück, als habe sie Feuer berührt.
Ein paar Stunden später verspürte er Schmerzen im Fuß, wo ihn die Nadel gestochen hatte. Im Mondlicht sah er, daß der Fuß dick angeschwollen war und bei jeder Bewegung weh tat.
Er weckte Chandra, damit der ihn ablöste und zeigte ihm das Bein.
„Das sieht aber schlimm aus“, sagte Chandra besorgt. „Die Geister haben dir die Wunde beigebracht“, weil du sie mit Füßen getreten hast.
„Ich habe sie nicht gesehen“, log Malindi. „Ich bin nur aus Versehen draufgetreten.“
„Vielleicht hattest du schlechte Gedanken, die dem großen Subedar nicht gefallen haben, und er hat dich dafür bestraft.“
„Quatsch, ich habe keine schlechten Gedanken. Ist denn der Gedanke an den Raub der Reliquie schlecht?“
„Nein, das glaube ich nicht. Wir erzürnen dadurch ja nicht die Götter, sondern nur die Singhalesen.“
Sie säuberten die Wunde, so gut sie konnten, aber nach zwei weiteren Stunden wurde Malindi schlecht, und er fieberte.
Er fing an zu phantasieren und redete fortlaufend von dem wilden Auge, das ihn ständig verfolgte. Manchmal flehte er auch laut die Götter und geheimen Kräfte an, sie mögen ihm vergeben wegen seiner schlechten Gedanken.
Am anderen Morgen hatten die Götter ein Einsehen, offenbar weil Malindi zerknirscht um Gnade gebeten hatte. Die Schwellung ging zurück, und das Fieber klang ab.
Mit einem wechselnden Gefühl aus Haß und Liebe blickte er auf die geheimnisvolle Nadel.
Er nahm sich vor, in Zukunft sehr vorsichtig zu sein.