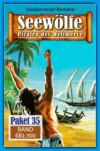Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 29
7.
April 1598.
England hatte mich wieder. Schon bevor wir in die Themsemündung einliefen, war ich an Deck und starrte mir die Augen aus. Dann schuftete ich wie ein Besessener, nur darauf bedacht, mitzuhelfen, daß die Karavelle möglichst flott flußaufwärts segelte.
Die Landschaft zog schnell vorbei. Wälder und Wiesen begrüßten uns mit einem frischen, zarten Grün, und selbst die Saat auf den Feldern sprießte schon. Ein lauer Frühlingsduft hing über dem Fluß und ließ mich die salzige Meeresluft vergessen. Scharen von Möwen folgten dem Schiff auf der Suche nach Kombüsenabfällen, die über Bord gekippt wurden.
Endlich erreichten wir London. Ich begrüßte die Piers und Stege, die Schiffe und das bunte Treiben im Hafen mit einem Freudenschrei. Noch vor wenigen Wochen hätte ich nicht geglaubt, daß ich all das jemals wiedersehen würde.
Die „Good Luck“ vertäute in einem Seitenarm. Am liebsten wäre ich sofort losgelaufen, doch entsann ich mich, daß ich meinen Rettern einen freundlicheren Abschied schuldig war.
Niemand hatte mich in die Schiffsrolle eingetragen. Trotzdem bat ich den Kapitän um Erlaubnis zum Abmustern.
„Willst du nicht doch auf der ‚Good Luck‘ bleiben?“ fragte er. „Ich kann einen guten Schiffsjungen brauchen.“
Er muß mir angesehen haben, was ich dachte, denn er fragte kein zweites Mal.
Cynthia wischte sich verstohlen Tränen aus den Augenwinkeln. Sie glaubte wohl, daß ich es nicht bemerkte.
„Schade“, sagte sie nur und zog mich kurz an sich.
Ich nickte stumm. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Die Zeit mit ihr hatte mich verändert.
„Ich wünschte, ich hätte eine Schwester, die so ist wie du“, stieß ich endlich hervor. Meine Stimme klang belegt.
„… und ich einen Bruder“, erwiderte Cynthia.
Dann schritt ich die Stelling hinunter. Ich wandte mich nicht mehr um. Das Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen war ungewohnt hart, außerdem schien der Boden leicht zu schwanken. Ich eilte die Pier entlang und schaute nicht mehr rechts und links. Zwischen den Magazinen bog ich in eine Seitengasse ab und erreichte wenig später die Hauptstraße mit ihren schmucken Häusern und dem steinernen Brunnen.
Am anderen Ende der Straße sah ich das rote Backsteinhaus mit den großen Fenstern, dem angebauten Lagerschuppen und dem kupfernen Firmenschild „B. & Th. Wingfield – Schiffsausrüster“. „B“ stand für Benjamin, das war mein Großvater, Gott hab ihn selig, und „Th“ für Theodore, meinen Vater.
Wie im Traum lief ich die letzten Schritte bis zum Haus, und diese Augenblicke fehlen auch heute noch in meinem Gedächtnis. Ich erinnere mich erst wieder, daß ich zitternd und überglücklich vor der mit Eisen beschlagenen Eingangstür stand und den aus Messing gegossenen schweren Türklopfer in die Hand nahm. Um die Zeit, es war mittlerweile nach acht Uhr abends, hatte das Geschäft schon geschlossen.
Dumpf dröhnte mein Pochen. Daß ich in den Fenstern kein Licht sah, bedeutete wenig, denn die Wohnräume lagen nach hinten, auf den Hof hinaus.
Ein Vierspänner ratterte hinter mir vorbei, die eisenbeschlagenen Bäder verursachten auf dem holprigen Pflaster einen Höllenlärm. Ich konnte nicht hören, ob sich im Haus Schritte näherten.
Also klopfte ich nochmals und ließ den stilisierten Anker mit Wucht gegen die Bohlen dröhnen.
Wenig später klappte eine Tür. Eine Stimme, der die Verärgerung über die späte Störung deutlich anzuhören war, forderte mich auf, gefälligst zu warten.
Das Herz schlug mir bis zum Hals, und die irrsinnigsten Gedanken schossen mir durch den Kopf. Dabei war ich nur ungefähr sieben Wochen von zu Hause fort gewesen. Natürlich war hier alles beim alten, was sollte sich auch geändert haben.
„Wer ist da?“
„Ich!“ Mehr brachte ich nicht heraus.
„Wer?“ erklang es zögernd. Hatte Vater mich nicht an der Stimme erkannt?
„Ich bin es, Clinton!“
Die schweren Riegel krachten in ihre Halterungen zurück, die Tür wurde jäh aufgerissen, und dann standen wir uns auf Tuchfühlung gegenüber. Nie werde ich Vaters ungläubigen Gesichtsausdruck vergessen. Er starrte mich an, als könne er nicht begreifen.
„Clint!“ stammelte er, und dann noch einmal: „Clint!“ Im nächsten Moment wurde ich fast zerquetscht, so ungestüm umarmte und wirbelte er mich hoch. Anschließend versetzte er der Tür einen Tritt, daß sie zufiel, verriegelte sorgfältig und folgte mir nach hinten.
Ich stand da bereits in der Wohnstube und blickte mich suchend um.
„Wo ist Mutter?“ fragte ich.
„Setz dich erst“, sagte Vater. „Ich habe gehört, daß du auf ein Schiff verschleppt worden bist. Bestimmt hast du sehr viel zu erzählen.“
„Ich“, hatte er gesagt, nicht „wir“. Und wo war Mutter? Ihre Krankheit, der Winter, der ständige Nebel an der Themse … Die Ungewißheit brachte mich fast um.
Vater hielt mich recht hart zurück, als ich aufsprang und die Treppe hinaufhasten wollte.
„Mutter schläft“, sagte er. „Es geht ihr heute nicht gut, sie braucht die Ruhe.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich kannte ihre Anfälle und wußte, daß sie stets innerhalb von zwei Tagen wieder abflauten, außerdem sagte Vater: „Morgen ist alles wieder in Ordnung. Anne wird glücklich sein, wenn sie dich sieht. Kein Tag ist vergangen, ohne daß sie sich um dich gesorgt hätte.“
Wir saßen bis nach Mitternacht beieinander, ich erzählte, und Vater hörte mir zu. Er unterbrach mich nur selten, und irgendwann schenkte er sich und mir einen Humpen Dünnbier ein.
„Du bist nun fast ein Mann, Clint“, sagte er mit feierlichem Ernst in der Stimme. „Wenn du eines Tages das Geschäft übernehmen wirst, haben dir die paar Wochen auf See bestimmt nicht geschadet.“
Meine erste Nacht an Land verbrachte ich in tiefem, traumlosem Schlaf. Am Morgen vermißte ich jedoch den Seegang und die stete Bewegung des Schiffes. Ich will nicht sagen, daß mir etwas fehlte, aber das Aufstehen fiel mir schwerer als sonst.
Vater hatte das Frühstück bereitet.
„Anne schläft noch“, sagte er. „Wir wollen sie nicht wecken.“
Er ließ das Geschäft geschlossen, und seltsamerweise erschien auch niemand, der etwas kaufen wollte. Wir redeten wieder – bis aus dem oberen Stockwerk plötzlich lautes Poltern erklang, gefolgt von dem schrecklichsten trockenen Husten, den ich je gehört hatte.
Nichts konnte mich nun noch zurückhalten, und ich war schneller als Vater die Treppe oben.
„Erschrick nicht!“ rief er hinter mir her. Da stieß ich schon die Tür zum Schlafzimmer auf.
Obwohl draußen strahlender Sonnenschein herrschte, waren die Vorhänge zugezogen. Lediglich ein tristes Dämmerlicht erfüllte den Raum.
Mutter hatte einen ihrer krampfhaften Erstickungsanfälle, sie keuchte und hustete und nahm nicht wahr, daß jemand eintrat. Sie wälzte sich vor dem Bett auf den Dielen, das war also das Poltern gewesen, das wir unten wahrgenommen hatten.
Mir stockte der Atem. Mutter hatte sich schrecklich verändert, ihre Augen blutunterlaufen und von tintenschwarzen Rändern umgeben, lagen tief in den Höhlen, ihre Wangenknochen traten kantig unter einer grobporigen Haut hervor, die Lippen waren blaß und von verkrustetem Blut bedeckt. Vorübergehend mußte ich an mich halten, um nicht entsetzt zurückzuprallen. Wäre ich ihr auf der Straße begegnet, hätte ich sie wahrscheinlich nicht erkannt. Das war ein trauriges Eingeständnis, entsprach aber durchaus den Gegebenheiten.
„Nun weißt du es“, sagte Vater tonlos hinter mir. „Ich hätte dir den Anblick gern erspart.“
„Aber – warum?“ fragte ich stockend. „Ich habe nicht geahnt, daß es so schlimm ist.“
„Der Arzt besucht uns zweimal in der Woche, und genausooft läßt er Anne zur Ader. Er kostet mich ein Vermögen.“
„Was sagt er?“
„Alles braucht seine Zeit, Junge. Wir sollen beten, daß wir einen warmen und trockenen Sommer kriegen, dann wird der Husten endlich aufhören.“
Wieder wurde Mutter von einem heftigen Anfall geschüttelt. Ich stützte ihren Rücken und hatte das Gefühl, daß es ihr guttat – zugleich spürte ich, daß sie bis auf die Knochen abgemagert war.
Endlich erkannte sie mich. Ein Aufleuchten huschte über ihr eingefallenes Gesicht.
„Du bist groß geworden, Clint“, sagte sie stockend und schwer verständlich. Ihre knochigen Finger tasteten liebevoll über meine Wangen. „Warum warst du gestern nicht bei mir?“
„Weil …“ Ich wußte wirklich nicht, was ich sagen sollte, ich fühlte mich unendlich hilflos.
„Weil wir viel zu tun hatten“, erklärte Vater. „Clint mußte einige Schiffe mit Waren beliefern.“
„Dann ist es gut.“ Ein zufriedenes Lächeln umspielte Mutters Mundwinkel, sie schloß die Augen und schien augenblicklich eingeschlafen zu sein, Vater hob sie ins Bett zurück. Er sagte nichts, aber das war auch nicht nötig.
In den folgenden beiden Wochen mußte ich hilflos und in ohnmächtigem Zorn mit ansehen, wie Mutter von Tag zu Tag mehr verfiel. Der Arzt erschien jetzt öfter und ließ sie länger zur Ader, zuletzt jeden zweiten Tag. Trotzdem wurde sie blasser und bestand nur noch aus Haut und Knochen. Einzig heiße Brühe nahm sie zu sich, aber ich mußte oft stundenlang auf ihrer Bettkante sitzen, damit sie aß.
Vater flüchtete sich ins Geschäft, als müsse er unbedingt nachholen, was er in letzter Zeit versäumt hatte. Von Nachbarskindern hörte ich, daß über längere Zeit hinweg geschlossen gewesen war.
Der Tag, vor dem ich mich unbewußt fürchtete, kam überraschend. Am Abend zuvor hatte es noch so ausgesehen, als wenn Mutters Zustand sich besserte, sie aß ihre Rindfleischbrühe mit den untergerührten Eiern, ohne daß ich ihr viel dabei helfen mußte, und ihre Augen schienen auch endlich wieder wie früher zu glänzen, aber am Morgen lag sie leblos in ihrem Bett. Sie hatte Blut gehustet und war wohl daran erstickt. Der Arzt konnte es sich nicht anders erklären, zumal seine häufigen Aderlasse zuletzt den erhofften Erfolg gezeigt hatten.
Die Beerdigung erfolgte im engsten Familienkreis. Da es ausgerechnet an dem Tag regnete, fühlte ich mich in meiner Trauer nur bestärkt.
Aber auch das ging vorbei wie alles andere zuvor. Vater nahm Aufträge an, die er kaum erfüllen konnte. Tag und Nacht schufteten wir, und wenn wir hundemüde in die Betten fielen, schliefen wir wenigstens sofort ein. Uns blieb dann keine Zeit, das schon vertraute Husten und Stöhnen zu vermissen, und das Haus erschien uns nicht so einsam.
Eigentlich fanden wir uns ganz gut zurecht.
Wie früher erledigte ich wieder die Botengänge und kleinen Besorgungen. Angst, daß ich erneut einer Preßgang in die Hände fallen könnte, hatte ich nicht. Allerdings trug ich jetzt einen Dolch hinter dem Gürtel versteckt, um mich im Falle eines Falles wirksam wehren zu können.
Eines Tages betrat Barry Thorne das Geschäft. Er war einer der Segelmacher, die regelmäßig bei uns einkauften, sobald ihr Schiff im Hafen von London vertäut hatte. Thorne erzählte von seiner neuen Heuer, einem Viermaster mit drei Decks und starker Armierung, einem Kriegs- und Expeditionsschiff unter hochherrschaftlichem Kommando. Das Schiff hieß „Respectable“, und es war bestimmt eine Freude, auf einer solchen Galeone über die Meere zu segeln.
Thorne suchte wie immer mit Kennerblick die beste Ware aus. Er kaufte etliche Ballen Segeltuch, Garn und verschiedenes Werkzeug und ließ alles auf den vor dem Geschäft wartenden Karren verladen. Nur einige Segelnadeln einer selten verlangten Größe hatten wir nicht vorrätig. Aber das war kein Problem.
„Morgen nachmittag läuft die ‚Respectable‘ aus“, sagte der Segelmacher. „Wenn ich mich darauf verlassen kann …“
Vater versprach ihm eine pünktliche Erledigung. Noch am Abend besorgte er mehrere Garnituren Nadeln in der Stadt. Bis er zurückkehrte, war es jedoch schon zu spät, den Liegeplatz der „Respectable“ aufzusuchen, das blieb für mich gleich nach dem Aufstehen.
Hätte ich damals gewußt, was mich erwartete, ich hätte bestimmt kein Auge zugetan …
Ich hatte das Gefühl, daß mir der Portugiese den Kiefer ausgerenkt, die Zähne verschoben und den Hals verdreht hatte, als er jähzornig zuschlug. Wäre ich nur sechs oder sieben Jahre älter gewesen, hätte ich ihm mit gleicher Münze zurückgezahlt.
Die Inder schleppten mich erneut in die enge Kammer unter Deck, aber wenigstens nahmen sie mir die Fesseln ab, bevor sie mich allein ließen.
Die Ratte war noch da. Aus dem Schicksal ihres Artgenossen hatte sie nichts gelernt, ihr Glück war vorerst nur, daß ich mich erst langsam von dem Schlag erholen mußte. Das Vieh nistete sich glatt auf meinem Bauch ein.
Allen Schmerzen zum Trotz, packte ich zu. Ich kriegte die Ratte an den Hinterbeinen und im Nacken zu fassen, und obwohl sie fürchterlich zappelte, schlug ich sie so lange auf die Planken, bis sie sich nicht mehr regte.
Danach war mir wohler. Ich schob den Kadaver möglichst weit von mir weg und wischte die blutverschmierten Hände am Schott ab.
Lange brauchte ich vermutlich nicht mehr zu warten. Die Piraten würden die Schebecke angreifen, sobald sie ihrer ansichtig wurden. Des erhofften Goldes wegen würden sie aber bestimmt nicht mit einer vollen Breitseite loslegen, sondern einen anderen Weg suchen, das Schiff zu kapern. Ich blieb unbehelligt, weil sie auf mich angewiesen waren, und hätte also, zumal ohne unangenehme Rattengesellschaft, die Nachtruhe genießen können. Trotzdem schlief ich lange nicht ein, weil ich mir den Kopf zermarterte, welche Möglichkeiten ich hatte, die Seewölfe zu warnen.
Nach Stunden war ich genauso schlau wie zuvor, ich mußte schlichtweg abwarten, wie sich mir die Situation darbot. Bis sich meine Aufregung endlich legte und die Müdigkeit die Oberhand gewann, war der neue Morgen nicht mehr weit.
Ich erwachte vom Schein einer blakenden Fackel. Die Flamme blendete, aber das war egal. Einzig und allein die Gewißheit zählte, daß die Schebecke nahe war.
Die Inder führten mich an Deck, aber sie fesselten mich nicht mehr. Wie hätten sie auch eine solche Behandlung erklären sollen?
Es war früher Morgen, eine fahle Dämmerung herrschte. Während der Nacht war Dunst aufgezogen, der sich erst zu lichten begann.
Ich erkannte, daß die Piraten die letzten Vorbereitungen für ein Gefecht trafen. Ihre Geschütze waren geladen und feuerbereit, nur noch nicht ausgerannt. Unter Deck wartete die Entermannschaft.
Vorlich, im Nebel gerade noch zu sehen, segelte die Schebecke. Aus welchem Grund die Arwenacks Laternen außenbords gehängt hatten, verstand ich nicht.
Der Glatzkopf Dragha lachte mir ins Gesicht.
„Ist das dein Schiff?“ fragte er.
Ich biß mir auf die Lippe. Keinen Ton würde der Kerl aus mir herauskriegen.
Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand umfaßte er mein Kinn und zwang mich, den Mund zu öffnen. Ich brachte aber nur ein heiseres Stöhnen hervor.
„Wenn du nicht reden, dann gut“, fauchte er mich an. „Aber dann kein Wort, sonst stirbst du schnell.“ Mit der Rechten zog er unter seinem Umhang eine entsicherte, doppelläufige Steinschloßpistole hervor.
Ich konnte mir lebhaft vorstellen, daß die Waffe die ganze Zeit über auf mich gerichtet sein würde. Falls etwas nicht nach dem Willen des Piraten verlief, war ich wohl der erste, den der Tod ereilte.
Kein angenehmer Gedanke, weiß Gott, aber eine bekannte Gefahr verliert ein wenig von ihrem Schrecken. Ich mußte versuchen, mich darauf einzustellen, und wenn ich es recht bedachte, hing das Schicksal der Arwenacks im Moment von mir ab.
Die Inder hielten stur auf die Schebecke zu. Natürlich hatten Kapitän Killigrew und seine Arwenacks die Pattamar längst entdeckt. Al Conroy und seine Helfer waren vermutlich dabei, die Geschütze zu laden. In Gedanken spielte ich alle möglichen Situationen durch, mußte aber feststellen, daß ich zu wenig vom Kämpfen verstand. Ich wußte nur, daß da kein Gras mehr wuchs, wo die Arwenacks hinlangten.
Während der weiteren Annäherung sah ich, daß die beiden Jollen ausgesetzt worden waren. Was, um alles in der Welt, wollten die Bootsgasten mehrere Kabellängen querab der Schebecke? Daß sie während der Nacht und im Schein der Laternen ihren über Bord gegangenen Moses gesucht hatten, erfüllte mich mit Stolz. Ich gehörte also wirklich und wahrhaftig schon zu den Korsaren des Seewolfs.
In der kleineren Jolle erkannte ich Piet Straaten, Sven Nyberg, Mac O’Higgins, Bill und den Gambiamann. Aufmerksam blickten sie zu der Pattamar, konnten mich aber nicht sehen, da ich von einigen Indern verdeckt wurde.
Die Männer im anderen Boot, das der Schebecke einige Dutzend Yards näher war, legten sich kräftig in die Riemen. Unverkennbar wollten sie den Dreimaster vor der Pattamar erreichen. Mac Pellew, Bob Grey, Luke Morgan, Stenmark, Smoky und Sam Roskill saßen auf den Ruderduchten, während Don Juan de Alcazar den Part des Bootssteurers übernommen hatte.
Der Wind wehte aus Ost bis Südost. Die Schebecke, mit Landkurs laufend, drehte leicht nach Steuerbord ab. Zum einen gewann sie damit an Höhe, zum anderen wurde der gesamten Backbordbatterie das Schußfeld geöffnet, und nach einer Halse, bei der sie den möglichen Angreifern nur die schmale Bugansicht darbot, konnten die Steuerbordgeschütze eingesetzt werden.
Dragha schätzte die Lage offenbar ähnlich ein. Er runzelte die Stirn in deutlichem Mißfallen.
„Nur mittlere Geschütze?“ herrschte er mich an.
Ich nickte.
„Geh vor! Winke den Inglés!“
Die Ausbeulung seines Umhangs in Hüfthöhe war unmißverständlich. Von der Schebecke trennten uns noch knapp fünfhundert Yards, als ich beide Arme hob und heftig zu winken begann. Spätestens jetzt mußten die Arwenacks aufmerksam werden, falls mich Dan O’Flynn mit seinem Adlerblick nicht schon vorher erkannt hatte.
Sie verkürzten zwar die Segelfläche, änderten aber nicht den Kurs. Dragha stieß eine heftige Verwünschung aus, die ich nicht verstand, die mir aber ein spöttisches Grinsen entlockte. Die Pattamar als am Wind segelndes Schiff war zum Beidrehen gezwungen. Nach einer überhastet ausgeführten Wende wurden die Segel so gegeneinander gestellt, daß sich ihre Vortriebskraft nahezu aufhob. Wir liefen nur noch geringe Fahrt.
Die Schebecke kam in Luv auf. Vorübergehend sah es so aus, als wolle sie uns rammen, doch dann legte Pete Ballie, unser Gefechtsrudergänger, so geschickt das Ruder, daß sie in einem Abstand von nur fünf Yards heranglitt. Das Besansegel war inzwischen bis an die Rahrute aufgegeit, Fock und Großsegel waren auf ein Drittel verkürzt.
Dragha hatte einen kurzen, aber heftigen Disput mit einem seiner Unterführer, der für die Geschützmannschaft zuständig war. Ich hätte viel dafür gegeben, hätte ich verstanden, über was sie sich stritten, aber offenbar wollte der Geschützführer das Feuer eröffnen, während sich Dragha fürs Entern entschied. Immerhin waren an Deck der Schebecke nur zwei Handvoll Männer zu sehen, mit denen er leichtes Spiel zu haben glaubte.
„Wir haben den Jungen gerettet!“ rief Dragha auf Portugiesisch. Er stand so dicht hinter mir, daß ich den Doppellauf seiner Pistole im Rücken spürte. Jetzt ein falsches Wort zu sagen, hätte meinen Tod bedeutet.
Leinen flogen von Bord zu Bord und wurden an Klampen und Pollern belegt. Die Bordwände näherten sich bis auf zwei Yards, dann brachte Big Old Shane die Stelling aus. Ich bemerkte, daß er mich eindringlich musterte, wie überhaupt jeder der an Deck befindlichen Arwenacks äußerste Anspannung erkennen ließ.
Die Culverinen der Backbordseite waren bis an die Stückpforten verholt, aber nicht ausgerannt. Al Conroy stand nicht nur zufällig in der Nähe eines abgedeckten kupfernen Kohlebeckens zwischen Gangspill und geöffneter Kuhlgräting.
Ben Brighton war dann noch da und Old Donegal, der scheinbar schläfrig am Kombüsenschott lehnte und seine Beinprothese angewinkelt hielt. Die Zwillinge standen auf dem achteren Grätingsdeck und blickten gelangweilt zur Pattamar. Daß die beiden Drehbassen binnenbords gerichtet waren, wirkte zumindest auf die Inder beruhigend.
Für weitere Betrachtungen blieb mir keine Zeit.
„Geh!“ raunte mir Dragha zu, faßte mich scheinbar freundschaftlich am Arm und schob mich zur Stelling.
Die Szenerie wirkte so unwirklich, daß ich am liebsten laut geschrien hätte. Mit jedem Schritt sank meine Hoffnung, daß die Arwenacks ihre Ahnungslosigkeit nur spielten. Die Männer lächelten jetzt, sie freuten sich, mich heil wiederzusehen, und gerade das mußte jeden Argwohn schon im Keim ersticken. Wahrscheinlich hatten sie den Tag und die Nacht hindurch nach mir gesucht, und die Männer, die ich an Deck vermißte, lagen in ihren Kojen und schliefen erschöpft. Draghas Plan schien aufzugehen.
„Namaßte.“ Der Seewolf, der an der Querbalustrade lehnte, bediente sich der allgemeinen Begrüßungsformel im Hindi-Indisch, und auf Portugiesisch fuhr er fort: „Die Freunde unseres Clinton Wingfield sind auch unsere Freunde.“
Dragha dirigierte mich da bereits über die Stelling, und hinter uns folgten ein Dutzend seiner Piraten.
Mir war jetzt alles egal. Mit einem heftigen Ruck riß ich mich aus Draghas Griff los und warf mich nach vorn, um aus seinem Schußfeld zu gelangen.
„Sir, Achtung!“ brüllte ich gleichzeitig.
Zwei Schüsse peitschten auf. Ich spürte, wie etwas siedendheiß über meinen Nacken hinwegraste, dann krachte ich mit der Stirn auf einen Balken und stürzte in einen dunklen Abgrund, der sich jäh unter mir auftat.
Бесплатный фрагмент закончился.