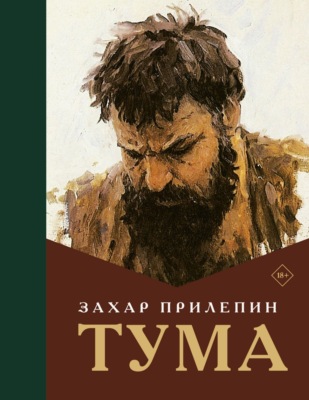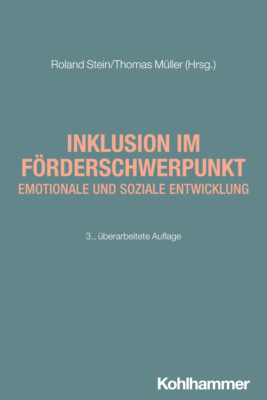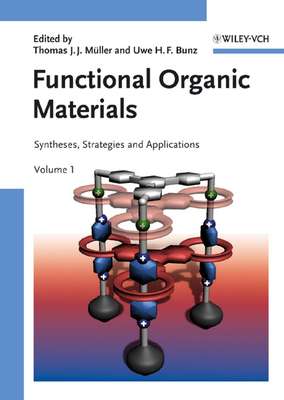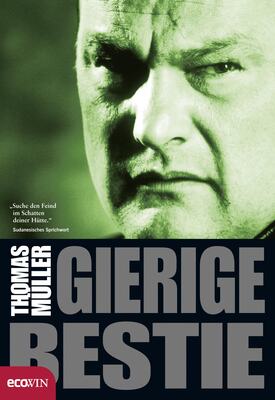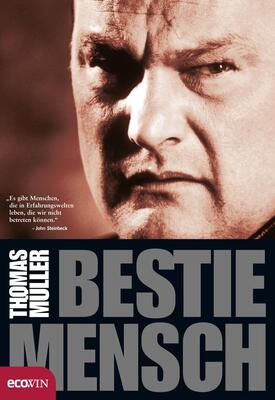Читать книгу: «Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen», страница 2
Neben diesen Hilfen zur Erziehung bietet der §35a Möglichkeiten der Eingliederungshilfe für von seelischer Behinderung bedrohte oder betroffene Kinder und Jugendliche. Diese Hilfen können ambulant, in teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in stationär therapeutischen Einrichtungen realisiert werden. Ergänzend kommt auch der §42, die Inobhutnahme, zum Zuge. Im Falle von Delinquenz bestehen darüber hinaus Möglichkeiten, Hilfen zur Erziehung mit den Sanktionen des Jugendgerichtsgesetzes (Jordan 2005, 227 f.) zu verbinden.
Empirische Untersuchungen (BMFSFJ 2002; Macsenaere / Klein / Scheiwe 2003) zeigen, dass gerade die Effekte der niedrigschwelligen, präventiven Maßnahmen teilweise problematisch sind, während stark interventive Maßnahmen wie etwa stationäre Unterbringung im Vergleich recht gut abschneiden. Die zentrale rechtliche Stellung der Sorgeberechtigten ist zwar stark, aber nicht immer „günstig“, denn das Recht und damit unter Umständen auch das Wohlergehen der betroffenen Kinder und Jugendlichen können dahinter zurückbleiben. Besonders deutlich wird dieses Problem bei massiven Erziehungsschwierigkeiten in der Familie, bei Gewalt, Misshandlung und Missbrauch. Zwar bestehen hier Eingriffsmöglichkeiten seitens des Jugendamtes; diese sind jedoch recht hochschwellig, was mitunter auch an Erfahrungen im Umgang mit Familiengerichten und deren Entscheidungspraxis liegt. Bis hier Maßnahmen greifen, kann viel geschehen sein, wenn es an Einsicht und Kooperationsbereitschaft seitens der Sorgeberechtigten mangelt.
Die Wirksamkeit erzieherischer Hilfen ist in verschiedenen Studien und Metaanalysen untersucht und belegt worden: Wolf (2007) verweist hinsichtlich der Wirkung erzieherischer Hilfen insbesondere auf die Passung des Hilfearrangements, die Partizipation von Jugendlichen und Eltern an den für sie wichtigen Entscheidungen, auf die Qualität der Beziehung, auf klare, Orientierung gebende Strukturen und Regeln, auf Respekt vor den bisherigen Lebenserfahrungen und den in diesem Rahmen entstandenen Strategien und Deutungsmustern. Macsenaere / Esser (2012) bestätigen diese Ergebnisse im Wesentlichen und weisen nach, welche Aspekte erzieherischer Hilfen in welchen Formen besonders wirksam sind.

Fragen zum Verständnis:
Wie veränderte sich der Auftrag der Schule für Erziehungshilfe von ihrer Entstehung bis heute?
Welche beiden Entlastungsfunktionen hat die Schule für Erziehungshilfe?
Welches sind wirksame Maßnahmen außerschulischer Erziehungshilfe?

Fragen zum erweiterten Verständnis und zur Vertiefung:
Was macht sonderpädagogische Institutionen, die nach außen hin einen separierenden Charakter haben, für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche möglicherweise zu integrativen Einrichtungen?
Warum werden sonderpädagogische Einrichtungen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung vermutlich auch in Zukunft unentbehrlich sein?
 Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.
Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.
 Grundlagenliteratur:
Grundlagenliteratur:
Macsenaere, M., Esser, K. (2015): Was wirkt in der Erziehungshilfe? Ernst Reinhardt, München
2.4 Integration und Inklusion
Mit der UN-Konvention von 2008 nahm die kritische Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit der Schulen für Erziehungshilfe zu. Dennoch hat sich die Zahl der in diesen Schulen geförderten Schülerinnen und Schüler zwischen 2001 und 2018 nahezu verdoppelt (KMK 2019b) und steigt weiter an. Aber auch Versuche integrativer Beschulung (z. B. regelschulintegrierte Klassen, Kooperationsklassen, ambulante und mobile Dienste und Hilfen, dezentrale schulische und außerschulische Erziehungshilfen, etc.) wachsen (s. thematische Skizze 4).

Thematische Skizze 4: Integration und Inklusion
„Der Weg zur Inklusion im Bereich der schulischen Erziehungshilfe wird dahinführen, bestehende Systeme weiter zu entwickeln, die sich fortsetzende Ausdehnung der separierenden Beschulung zu stoppen, zu reduzieren und inkludierende Förderformate auszuweiten […]. Ziel ist es, gestufte Fördersysteme mit differenzierten Ansätzen und intensiver Vernetzung v. a. mit der Jugendhilfe, flächendeckend zu etablieren […]“ (Willmann 2007, 130).
Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche sind oft vielfältigen Exklusionserfahrungen ausgesetzt: dazu zählen massive Konflikte in der Familie ebenso wie im häuslichen Umfeld, in Kindergarten oder Schule. Diese Erfahrungen sind bisweilen tiefgreifend und führen bei ihnen selbst, aber auch in ihrem Umfeld vielfach zu Leid und Trauer, auch wenn es angesichts von Wutausbrüchen, Übergriffen und zerstörerischem Verhalten auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Die Biographien der Betroffenen belegen dies jedoch „eindrucksvoll“ (Nölke 1994; Ader / Schrapper 2002; Hamberger 2008; Goblirsch 2010).
Die Schule, aber auch ein erheblicher Teil der Hilfemaßnahmen zur Erziehung sind so organisiert, dass sie auf ein gewisses Maß an Gruppenfähigkeit setzen. Es gibt jedoch Kinder und Jugendliche, die durch ihre biographischen Erfahrungen emotional und sozial so hoch belastet sind, dass sie nur wenige oder kein anderes Kind neben sich ertragen. Jenseits von zunehmender Professionalisierung im Bereich der allgemeinbildenden Schulen wird es daher auch weiterhin schulische Maßnahmen benötigen, die solchen Bedarfen gerecht werden. Darüber hinaus wäre es fahrlässig anzunehmen, dass jede Verhaltensweise eine Bereicherung innerhalb einer Klasse darstellt, besonders, wenn es zu gewalttätigen oder sexuell motivierten Übergriffen, selbstverletzendem Verhalten und Delinquenz kommt. In der Diskussion um Inklusion wird bisweilen aber ein zu idealistisches Bild vermittelt:
„Es scheint so, als träfen ausschließlich Schüler aufeinander, die guten Willens sind, bereit und in der Lage, sich miteinander zu verständigen. Auftretende Probleme sollen mit den gängigen pädagogischen Mitteln gelöst werden, eventuell unterstützt durch sonderpädagogische Hilfen. Aggressivität und Destruktivität, die diesen gemeinsamen Rahmen sprengen, haben im Normalitätstheorem keinen Platz, Grenzen einer fruchtbringenden Vielfalt kommen nicht vor“ (Ahrbeck 2011, 65).
Die Inklusionsdebatte sollte nicht den Eindruck erwecken, als sei das Miteinander von unterschiedlichen Menschen in der Verbindung zu einer Lerngemeinschaft grundsätzlich gut. Die Zunahme des emotional-sozialen Förderbedarfs (KMK 2020) sowie die Tatsache, dass etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen an einer psychischen Störung erkranken (Hölling et al. 2008), lässt den Schluss zu, dass es eine intensive Unterstützung aller Schularten benötigt, besonders dann, wenn sie sich den Herausforderungen eines inklusiven Unterrichts stellen. Im Sinne der Kinder und Jugendlichen, die niemanden neben sich aushalten (können) und im Sinne derer, die es vor Übergriffen zu schützen gilt, werden spezielle Schulen auch in Zukunft unerlässlich sein. Wo diese Schulen abgeschafft werden, droht die Gefahr, dass verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche eine „In-klusion“ der anderen Art erleben: nämlich Einschluss in Psychiatrien, Forensiken und Justizvollzugsanstalten.
„Inklusion verwirklicht sich also nicht unbedingt mit dem Verbleib von störenden, auffälligen oder schwierigen Kindern und Jugendlichen an Regelschulen, genauso wenig wie die Schule zur Erziehungshilfe als Allheilmittel gelten kann. […] Ziel bleibt es, diesen Kindern und Jugendlichen Stabilität und Verlässlichkeit, Kontinuität und Orientierung, Wertschätzung und Anerkennung anzubieten, wie auch immer man die Schulen, die das realisieren können, systemisch verorten mag“ (Müller 2013, 43).
Aktuell steht die Pädagogik bei Verhaltensstörungen vor zwei großen Herausforderungen: dem „wait-to-fail-Problem“ und dem „Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma“. In vielen Fällen wird mit sonderpädagogischen Interventionen solange gewartet, bis das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen in der Regelschule nicht mehr tragbar ist. Oftmals haben sich Verhaltensweisen dann manifestiert und lassen sich auch durch gezielte Maßnahmen nicht mehr in den Griff bekommen, was im schlimmsten Fall zu späten Schulwechseln, aber auch Abbrüchen ohne Abschluss führt. Daher befasst sich die Pädagogik bei Verhaltensstörungen explizit mit Fragen der Prävention sowie der Wirksamkeit eingesetzter Maßnahmen (z. B. Hartke / Koch 2008; Hennemann et al. 2015), auch wenn damit Erziehungsprozesse nicht abgelöst werden können (Stein / Müller 2018, 258). Damit einher geht das Dilemma, dass Ressourcen für eine sonderpädagogische Intervention erst dann zur Verfügung gestellt werden, wenn eine Störung im Verhalten und / oder Erleben diagnostiziert wurde. Dies erfordert zum einen Zeit, in der sich Verhaltensweisen verfestigen können und leidvolle Erfahrungen vergrößern. Es bringt zum anderen das Problem mit sich, die Betroffenen ggf. zu stigmatisieren, selbst wenn dies nicht beabsichtigt ist (Kap. 4.3.4). Förderbedarfe aus Angst vor Stigmatisierung jedoch nicht mehr festzustellen, bringt wiederum die Gefahr mit sich, dass (existentiell) notwendige Hilfe, Unterstützung und Begleitung ggf. nicht realisiert werden können. Es bleibt zu überlegen, ob im Sinne einer advokatorischen Ethik, jenseits von paternalistischen Absichten, nicht genau dies das immer wieder zu reflektierende Wagnis ist, welches die Pädagogik bei Verhaltensstörungen einzugehen hat.
Mit Blick auf eine inklusive Zukunft hat die Pädagogik bei Verhaltensstörungen ihre Professionalität in mindestens drei Handlungsfelder einzubringen:
● Zum einen gilt es, eine präventive pädagogische Praxis in der Elementarbildung auszubauen,
● zum zweiten eine integrative und inklusive pädagogische Praxis an Regelschulen weiterzuentwickeln, ohne Exklusion in der Inklusion zu erzeugen,
● und zum dritten geht es um den Erhalt sonderpädagogischer, schulischer und außerschulischer Intensivangebote sowie ihre Weiterentwicklung im Hinblick auf Aufenthaltszeiten, Durchlässigkeit und Übergänge, aber auch konzeptionelle Qualitäten.

Fragen zum Verständnis:
Was ist mit dem „wait-to-fail-Problem“ gemeint?
Welche grundsätzlichen Versuche einer integrativen Beschulung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher gibt es?
Weshalb muss sich gerade die Pädagogik bei Verhaltensstörungen mit präventiven Maßnahmen auseinandersetzen?

Fragen zum erweiterten Verständnis und zur Vertiefung:
Lässt sich das Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma auflösen? Wenn ja, wie?
Wie könnte ein gelingendes inklusives Bildungssystem aussehen, in welchem auch verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche ihren Platz finden?
 Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.
Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.
 Grundlagenliteratur:
Grundlagenliteratur:
Stein, R., Müller, T. (Hrsg.) (2018): Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Kohlhammer, Stuttgart
3 Begriffe und Ordnungen

Jede Wissenschaftsdisziplin verfügt über eigene Begrifflichkeiten, um ihren Gegenstandsbereich zu strukturieren. Dies geschieht immer wieder neu und ist nicht abschließend möglich. Als Fach, das sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und ihren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche befasst, aber auch mit den Wirkungen ihrer Verhaltens- und Erlebensweisen auf die Gesellschaft, ist ein Zugang über Werte, Normen und Normalität bedeutsam. Daraus lassen sich Definitionsversuche ebenso ableiten wie Versuche der Rekonstruktion des Gegenstandsbereichs. Klassifikationen wollen die Vielfalt bündeln und epidemiologische Erkenntnisse geben Auskunft über die Verbreitung spezifischer Phänomene.
Aufgabe der Pädagogik bei Verhaltensstörungen als Wissenschaftsdisziplin ist es, Fachbegriffe zu bilden, zu begründen, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Insbesondere in einem Arbeitsfeld, in dem die Betroffenen Opfer von Stigmatisierung und Ausschluss werden können (Kap. 2.3 und 2.4), ist dies bedeutsam. Spricht man über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, öffnet sich ein Kosmos verschiedener Begriffe: „Verhaltensstörungen“, „Verhaltensauffälligkeiten“, „emotional-sozialer Förderbedarf“, „Verhaltensbehinderung“, „abweichendes Verhalten“, „verhaltensoriginell“, „Erziehungsschwierigkeiten“ oder „Kinder und Jugendliche mit überraschendem Verhalten“ (Goetze 2001, 12).
Jede Begrifflichkeit ist „Ausdruck des dahinter stehenden Denkens und Verstehens“ (Stein 2019, 9 f.), sodass die jeweilige Auffassung den Umgang und das Verständnis des beschriebenen Phänomens mitbestimmt. Dies wiederum beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung, aber auch die ggf. zur Verfügung stehenden Unterstützungsmaßnahmen. Zudem wirken sich Begriffe und die hinter ihnen stehenden Auffassungen auf pädagogisches Handeln und die Sichtweisen Professioneller aus, denn ihre Einstellungen sind ausschlaggebend für die Arbeit mit den Betroffenen. Es ist daher unerlässlich, diese in Theorie und Praxis zu reflektieren.
Was genau unter einer Störung, Auffälligkeit, Behinderung oder Förderbedürftigkeit verstanden wird, kann erheblich differieren: während die einen Störung als Steigerung von Auffälligkeit auffassen, verbergen sich für andere sehr spezifische Sichtweisen hinter beiden Begriffen, die in unterschiedliche Verhältnisse zueinander gebracht werden können: in die personorientierte, die systemische und die interaktionistische Sicht.
Auch der Begriff „emotional-sozialer Förderbedarf“ ist zu hinterfragen: Da sich ein Förderbedarf immer auf ein einzelnes Kind oder einen einzelnen Jugendlichen bezieht und an diesem festgemacht wird, steht er ähnlich oder möglicherweise sogar noch stärker als der Störungsbegriff in der Gefahr, Verhaltensweisen ursächlich zu personalisieren, und verhindert eine Sichtweise, in der die Störung als Zustand begriffen wird, der (nur) in einer bestimmten Situation zwischen bestimmten Menschen existiert oder als solcher von anderen beobachtet werden kann.
Zudem verbreiten sich, besonders im Zuge der Diskussion um Inklusion, Formulierungen wie „Verhaltensoriginalität“, „überraschendes Verhalten“ oder auch „Kinder und Jugendliche mit kreativem Verhalten“. Damit jedoch droht die Gefahr, dass belastende lebensgeschichtliche Erfahrungen, wie beispielsweise massive Gewalt oder sexueller Missbrauch, welche zu auffälligen Verhaltensweisen führen können, verharmlost und nivelliert werden. In einer Situation ein Verhalten zu zeigen, das überrascht, originell oder kreativ erscheint, ist das eine. Das andere sind Verhaltensweisen, die ursächlich oft mit Leid, Schmerz und Verzweiflung verbunden sind. Hinzu kommt, dass viele Verhaltensweisen nicht so überraschend oder kreativ sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen, sondern vielmehr stereotyp, festgefahren und vorhersehbar; vor allem dann, wenn man sich auf das dahinter liegende subjektive Erleben einlässt.
3.1 Werte, Normen und Normalität
Ein Wert bzw. eine Wertaussage beschreiben eine Beziehung zwischen einem Subjekt und einem Gut. Eine Norm ist dagegen ein Satz, der eine Handlung erlaubt, gebietet oder verbietet. Über Werte lässt sich daher nur etwas in der ersten Person aussagen, während von Normen immer in der dritten Person die Rede ist. Werte und Normen spielen in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten als soziales Phänomen eine wichtige Rolle, insofern sie die Personen betreffen, die als auffällig bezeichnet werden, aber auch jene, die eine Auffälligkeit beschreiben oder diagnostizieren (s. thematische Skizze 5). Wer ein Verhalten als auffällig bezeichnet, geht dabei stets von einer bestimmten Bezugsnorm aus. Verhaltensauffälligkeiten ergeben sich aus einem Vergleichsmaßstab heraus, für das, was als nicht auffällig oder als nicht normal gilt. Zur Klärung eines als auffällig eingestuften Verhaltens ist der „Rahmen“, in welchem das Verhalten gezeigt und beobachtet wird, von großer Bedeutung. Zudem spielt die soziale Gruppe, in der sich das Individuum befindet, eine wichtige Rolle.

Thematische Skizze 5: Werte, Normen und Normalität
● Legt man eine individuelle Bezugsnorm an, werden Verhalten und Erleben anhand der Verhaltens- und Erlebensweisen des Individuums an diesem selbst beurteilt und gemessen. Im Vordergrund steht also, welche Verhaltensweisen für diese Person typisch sind und welche aus typischen Verhaltensmustern herausfallen.
● Bei einem Situations- oder Sachbezug geht es zum einen um ein Verhalten, welches aufgrund der Situation, in der es gezeigt wird, als angebracht oder als unangebracht beurteilt wird; und zum anderen um den situationsangemessenen Umgang mit einer Sache.
● Bei einem gesellschaftsbezogenen Maßstab orientieren sich Personen hinsichtlich des Verhaltens häufig an Normen, welche in einem Kulturkreis oder einer sozialen Gruppe vorherrschen. Diese Normen werden zur Bewertung eines Verhaltens herangezogen. Normen und Werte sind jedoch zeit- und kulturabhängig und folglich, ebenso wie Verhaltensauffälligkeiten, relativ und abhängig von anderen Größen, Bezugssystemen und Gegebenheiten.
Bach (1989, 11 f.) unterscheidet für die Beurteilung und das Ausmaß die situative, die soziale, die altersgemäße, die weltanschauliche und ethnische, die epochale, die geschlechtsbezogene und die Beurteilungsrelativität voneinander. Eine mögliche Definition von Verhaltensauffälligkeiten müsste daher derartigen Relativitäten gerecht werden, indem sie diese abbildet oder zumindest auf sie verweist.
Ein anderer Weg der Annäherung könnte über verschiedene Dimensionen der Normsetzung erfolgen. Seitz (1982, 11 f.) unterscheidet dabei wie folgt:
● Explizite Normen sind gesetzlich verankerte Regeln. Normgerechtes und normabweichendes Verhalten ist in Gesetzen festgeschrieben und wird durch festgelegte Instanzen sanktioniert.
● Soziokulturelle Normen dagegen sind gesellschaftsabhängig und in einer sozialen Gruppe, Gesellschaft, Gemeinschaft oder auch Ethnie verbreitet. An ihnen orientieren sich die Mitglieder in ihrem Verhalten und in dessen Bewertung. Sie gehen einher mit beispielsweise weltanschaulichen, religiösen und volkstumbezogenen Relativitäten und können daher in verschiedenen Gruppierungen erheblich differieren.
● Statistische Normen unterliegen dem Gesetz der Zahl und werden, oft mithilfe der Entwicklungspsychologie, zur Normbildung herangezogen. Es gilt das Verhalten als normal, welches in einer Gruppe von Personen zu einem gewissen Zeitpunkt am häufigsten auftritt. Verhalten kann daher in zweierlei Hinsicht als auffällig bewertet werden: einerseits nach unten und andererseits nach oben abweichend.
Eine weitere Möglichkeit der Normsetzung ist mit psychologisch-fachwissenschaftlichen Erkenntnissen über „regelrechtes“ oder „gesundes“ Verhalten verbunden. Es handelt sich hierbei um die Bewertung von Verhaltensweisen auf Grundlage spezifischer Modelle, beispielsweise der Bindungstheorie (Kap. 4.2.3). Ob es individuelle Normen gibt, ist eher fraglich, aber die persönlichen Idealvorstellungen eines Beobachters können letztlich auch zur Normsetzung dienen. Maßstäbe basieren unter anderem auf persönlichen Erfahrungen und Überlegungen der Beurteilenden und führen dazu, dass eine Person etwas als auffällig oder unerwünscht bezeichnet, das von einer anderen Person als angemessen oder erwünscht angesehen wird.
Bisher nicht berücksichtigt wurde die Frage, wie unabhängig eine als auffällig bezeichnete Person ihr Verhalten und Erleben selbst bewertet:
„[…] betroffen sind Kinder mit massiven Verhaltensstörungen, die wiederholt und in unterschiedlichen Erfahrungsräumen erleben müssen, dass sie sich als Person nicht verdeutlichen können. […] Ihre Botschaften laufen ins Leere: […] unter anderem deshalb, weil ihre inneren Notwendigkeiten keine andere Lösung zulassen. Sie bleiben unverstanden, weil sie sich selbst nicht verstehen, sind in sich selbst verfangen und verstricken andere gleichermaßen“ (Ahrbeck 2011, 61).
Aus pädagogischer Sicht müssen immer auch die subjektiven Maßstäbe, die inneren Notwendigkeiten und guten Gründe einer Person, sich so und nicht anders zu verhalten, Berücksichtigung finden. Dies ist durchaus herausfordernd, denn oft
„halten wir unsere Wahrnehmung für Gewissheit und vergessen dabei, dass das, was wir nicht verstehen, die Gewissheit von Anderen sein kann. […] Nur wer imstande ist, das eigene Echo im vermeintlich Fremden zu erkennen, kann sich von Vorwürfen und Schuldzuweisungen befreien und sich dem Gegenüber annähern“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 11).
Norm und Normalität können „ineinander fallen“, aber auch sehr weit auseinander liegen. Der Begriff des „Normalen“ umfasst vieles, lässt sich aber auch eingrenzen. Der Begriff tauchte erstmals in der zweiten Hälfte des 18. Jhd. im Zusammenhang mit Massenproduktion und der Erhebung von Massendaten auf und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem gesamtgesellschaftlichen Topos, erkennbar an Aspekten wie der Gauß‘schen Normalverteilung, Statistiken, Festlegungen in Medizin und Psychologie, aber auch in der Industrie mit Bezug auf technische Normalgrößen. Normalität ist ein relatives Maß, abhängig von Kultur und Zeit. Daraus folgt: Was normal ist, wandelt sich. Westeuropäische Gesellschaften lassen sich als flexibel normalistisch charakterisieren – im Gegensatz zu protonormalistischen Gesellschaften, die von starren Vorstellungen oder Ideologien geprägt sind. Nach dem Modell der flexiblen Normalität orientieren sich Menschen daran, was andere Menschen machen oder was sie von Politik, Medien, Kirche u. a. als Orientierungsmarken für Normalität aufgezeigt bekommen. In diesem Sinne sind es die Menschen selbst, die im Zusammenspiel mit den vorhandenen Normalisierungsangeboten bestimmen, was normal ist und was nicht. Daraus wird deutlich, dass Normalität auch mit Diskursen verbunden ist. Was normal ist, wird unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft immer wieder neu verhandelt. Dabei treffen diese Diskurse auch auf statistische Maße, die sich auf das durchschnittliche Verhalten der Mehrheit einer Bevölkerung beziehen, woraus die Frage entsteht, ob sich Normalität immer am Durchschnitt messen lässt. Normalität orientiert sich zwar oft am statistischen Durchschnitt, aber man kann sie nicht mit diesem gleichsetzen.
Normalität ist von Normen zu unterscheiden, denn diese regeln das Zusammenleben und haben zum Ziel, dieses zu erleichtern, überschaubarer, gerechter und vergleichbarer zu machen. Normen haben einen präskriptiven Charakter im Sinne ihrer Erfüllung bzw. gegebenenfalls drohender Sanktionen. Normalität ist dagegen im deskriptiven Sinne eine Orientierung, die, richtet man sich nicht an ihr aus, Risiken, aber auch Entwicklungschancen mit sich bringen kann. So ist es für manche Menschen kein Kompliment, als normal zu gelten: sie halten sich und ihr Leben für einzigartig und wollen auf keinen Fall sein wie alle anderen. Auch in der Kunst ist die Überschreitung dessen, was Norm und Normalität vorgeben, immer wieder notwendig, um Neues zu schaffen. Dieses Spannungsverhältnis greift Ahrbeck auf, wenn er mit Blick auf den Inklusionsdiskurs festhält:
„Wenn es normal ist, anders zu sein, was ist mit denjenigen, die diesen Gemeinschaftswunsch nicht teilen? Auch sie können sich auf ihre Besonderheit berufen, auf ein spezielles Anliegen zur Selbstverwirklichung und eine subjektive Interessenslage, die von denjenigen der Mehrheit abweicht. Sollen sie auf ihre Individualität verzichten? Kann und darf man sie zwingen […] zugunsten des Gemeinschaftsprinzips auf ihre ureigensten Wünsche zu verzichten“ (Ahrbeck 2011, 62)?
Mit Blick auf verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche muss insbesondere vor einer Inflation der Normalitätsidee gewarnt werden. Wenn Verschiedenheit zur Normalität erklärt wird, dann mag dies manche Menschen in ihrer Lebensweise von Stigmatisierungen zu einem „normalen“ Leben hin befreien. Dort wo diese Verschiedenheit sich in Verhaltensweisen ausdrückt, die entweder Ergebnis leidvoller Erfahrungen durch Gewalt, Missbrauch, psychische Misshandlung und emotionale Verwahrlosung sind oder aber dazu führen, dass andere Kinder und Jugendlichen unter übergriffigen Verhaltensweisen zu leiden haben, ist eine derartige Normalisierung von Verschiedenheit naiv und zugleich menschenverachtend.
„Es ist normal, anders zu sein: Mit dieser Formel haben insbesondere Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten, die im starken Maße emotionale Beeinträchtigungen aufweisen. Nicht, dass es in ihrer inneren und auch äußeren Lebenssituation keine Besonderheiten gäbe. Im Gegenteil: Sie existieren sehr wohl und oft im Übermaß. Ihr Problem besteht vielmehr darin, dass sie aufgrund ihres Andersseins den gestellten Gemeinschaftsanforderungen nicht entsprechen können: selbst dann, wenn sie es mit aller Kraft wollen. Ihre inneren Notwendigkeiten lassen ihnen keine Wahl: Sie erzwingen es, dass sie immer wieder in Widerspruch zu gängigen Normalitätsanforderungen geraten. Mit Verhaltensweisen, die für andere schwer erträglich und mitunter beim besten Willen nicht auszuhalten sind. […]. Das ist ein Teil der Normalität ihres Lebens“ (Ahrbeck 2011, 63 f.).
Normalität stellt eine terminologisch graue Masse dar, sie lässt sich nie vollständig greifen, wohl aber in ein reflexives Verhältnis zu geltenden Normen setzen. Die Fähigkeit des Menschen, Regelmäßigkeiten zu benennen, sie in Formeln umzusetzen oder in Modellen darzustellen und zur Grundlage auch der pädagogischen Professionen zu machen, ist Chance zu Verständigung und Entwicklung gleichermaßen.

Fragen zum Verständnis:
Weshalb sind Normen relativ?
An welchen Bezugsgrößen können sich Normen festmachen?
Was ist mit der Aussage „Was normal ist, wandelt sich“ gemeint?

Fragen zum erweiterten Verständnis und zur Vertiefung:
Wie beeinflussen sich Norm und Normalität gegenseitig?
Warum ist es aus der Perspektive der Pädagogik bei Verhaltensstörungen nicht normal, verschieden zu sein?
 Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.
Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.
 Grundlagenliteratur:
Grundlagenliteratur:
Ahrbeck, B. (2011): Der Umgang mit Behinderung. Kohlhammer, Stuttgart
3.2 Definitionen
Die Definition von Myschker und Stein (2018) legt den Schwerpunkt zum einen auf die Genese von Verhaltensstörungen, zum zweiten auf ihre Manifestation und zum dritten auf die Hilfe, die sich daraus ableiten lässt:
„Verhaltensstörung ist ein von zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und / oder milieuaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht und nur unzureichend überwunden werden kann“ (Myschker / Stein 2018, 56).
Ein zentraler Aspekt der Definition umfasst die Kriterien einer Störung. Diese sind die zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen, wodurch Umwelteinflüsse berücksichtigt werden. Des Weiteren verweisen sie auf Anlässe für die Entstehung von Verhaltensstörungen. So basieren ein abweichendes und schlecht angepasstes (maladaptives) Verhalten auf organischen Gründen oder milieuaktiven Bedingungen. Darunter fallen unter anderem Sozialisation und Erziehung. Zudem finden sich die Auswirkungen einer Störung wieder, die negativen Einfluss auf unterschiedliche Lebens- und Entwicklungsbereiche des Individuums hat, was zu besonderer Hilfebedürftigkeit führt – Hilfe in Form professioneller pädagogischer und therapeutischer Unterstützung. Verhalten verstehen Myschker / Stein dabei als „die Gesamtheit menschlicher Aktivitäten […], die im Wechselspiel zwischen Organismus und Umwelt generiert werden“ (Myschker / Stein 2018). Damit lenken sie den Blick hinsichtlich Verhaltensstörungen sowohl auf personale als auch soziale Umstände, womit Aspekte einer interaktionistischen Perspektive angedeutet sind, Tendenzen zu einer eher personenorientierten Definition sowie den damit verbundenen Problemen aber nicht aufgehoben werden. So konstatieren sie mit Blick auf die Definition selbst:
„Mit dieser Definition soll – was im Hinblick auf Missverständnisse und spezifische theoretische Positionen anzumerken ist – ein Begriff, der sich eingebürgert hat, der sehr unterschiedliche Phänomene zusammenfasst […], die mit den unterschiedlichsten Ursachen zusammenhängen können, in einer Weise präzisiert werden, dass er der fachlichen Kommunikation auf hohem Abstraktionsniveau, aber auch einem so wichtigen Bereich wie der Diagnostik dienlich sein kann“ (Myschker / Stein 2018, 56).
Bach hingegen richtet mit seiner Definition von Verhaltensstörungen den Blick auf die Aspekte der Systeme, der Beobachter und der Beurteilung.
„Unter Verhaltensstörung soll die Art des Umgangs eines Menschen mit anderen, mit sich selbst und mit Sachen verstanden werden, die von der erwarteten Handlungsweise negativ abweicht, indem sie als sinnvolle Zustände oder Handlungsabläufe, Zusammenleben oder individuelle Entwicklung gefährdend, beeinträchtigend oder verhindernd angesehen wird“ (Bach 1989, 5).
Er verweist darauf, dass es „nicht ein Verhalten an sich ist, das die Störung ausmacht, sondern die Diskrepanz zwischen einem von einem Beurteiler in bestimmten Situationen erwarteten und dem faktisch gezeigten Verhalten eines Menschen“ (Bach 1989, 6). Demnach setzt sich eine Störung des Verhaltens aus der Beziehung zwischen einem bestimmten Verhalten und einem Beurteiler zusammen. Weiterhin schließt er alle Lebensalter mit ein, da, seiner Ansicht nach, Auffälligkeiten in jeder Lebenslage und jedem Alter auftreten können. Auch hinsichtlich der Entstehungsmöglichkeiten beinhaltet die Definition keine Einschränkung. Auffälligkeiten, die von einem Beurteiler fälschlicherweise als Verhaltensstörung klassifiziert wurden, bezeichnet er als Pseudoverhaltensstörung. Störungen die „besonders umfangreich, in verschiedenen Situationen, schwerwiegend und zeitlich überdauernd zutage treten“ (Bach 1989, 12) fasst er unter dem Terminus der Verhaltensbehinderung zusammen. Bachs Definition beschreibt Verhaltensstörungen also als Diskrepanz zwischen dem erwarteten und dem gezeigten Verhalten, wobei die Störung bei der Person selbst, sei es in der Position des Sich-Verhaltenden, sei es in der des Beurteilenden verortet wird, was sie letztlich, trotz des systemischen Fokus, in die Nähe einer personenorientierten Definition rückt.
Начислим
+49
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе