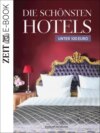Читать книгу: «Aufstieg durch Bildung?», страница 3
Das ist die Kurzfassung etlicher Studien zum Ertrag frühkindlicher Bildung: Vor allem die Kinder aus armen Familien profitieren davon.
Jutta Allmendinger, die Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin, schreibt: Migrantenkinder, die in der Krippe waren, gehen doppelt so häufig aufs Gymnasium wie die, die zu Hause betreut wurden. Der amerikanische Nobelpreisträger James Heckman hat berechnet, dass ein Land von jedem Dollar, den es in die frühe Förderung der Ärmsten investiere, einen Nutzen von sieben bis zwölf Dollar habe, weil es Sozialkosten spare und Steuern einnehme.
Auch die Kita der Siedlung hatte, wie die Schule, zeitweise einen sehr hohen Migrantenanteil: 92 Prozent. Jetzt liegt er bei 80. Denn die Kita-Leiterin hatte eine Idee. Weil Krippenplätze für die ganz Kleinen auf beiden Seiten der Kluft knapp sind, richtete man große Räume in der Dachetage ein – eine Extragruppe für die Allerkleinsten. Dorthin bringen nun auch Eltern aus den Altbauten ihre Kinder.
Alle hätten sich sehr gefreut, erzählt die Leiterin. Doch bald waren die Kinder der Mittelschichtseltern wieder weg, nämlich als sie in die Gruppen für die Älteren wechseln sollten, zu den Jungen und Mädchen aus der Siedlung. »Die Eltern waren zufrieden mit unserer Arbeit«, sagt die Leiterin, »aber dann hieß es: Nee, das ist mir nicht so recht, viele arabische Kinder, laute Kinder.«
Das fand die Kita-Leiterin schade. Deshalb hat sie noch einmal überlegt, ob man ihre Idee nicht weiterentwickeln könnte – und den Eltern aus der oberen Etage in diesem Jahr ein Angebot gemacht: Ihre Kinder sollten gemeinsam wechseln können. In eine Gruppe. Zu einer Erzieherin, die sich die Eltern aussuchen durften. »Das hat geklappt«, sagt die Leiterin. So haben sie jetzt in der Kita eine ganz besondere Gruppe, in die die fünf Mittelschichtskinder aus der Dachetage gehen.
»Wir stürzen jetzt auch in diesen Konkurrenzkampf der Institutionen um die Mittelschichtskinder«, sagt der Mathelehrer der Grundschule. Und dann erzählen die Lehrer, dass sie dieselbe Methode anwenden wie der Kindergarten: Den Eltern der begehrten Kinder bieten sie besondere Konditionen an, schulen etwa eine Gruppe von Mittelschichtskindern gemeinsam in eine Klasse ein. »Wir kommen diesen Eltern ziemlich weit entgegen«, sagt der Mathelehrer.
Ist das tatsächlich ein Weg, um die Kluft zu überwinden? Darf man Kinder in »attraktiv« und »unattraktiv« einteilen? Um die einen wirbt man, die anderen nimmt man hin? Sind ndH und Lmb die Faktoren, die eigentlich anzeigen sollen, wo der Staat helfen muss, inzwischen vor allem ein Kompass, der angibt, welche Schule Eltern umschiffen sollten? Darf man Kinder nach Herkunft und Haarfarbe ordnen?
Im vergangenen Sommer ist die Lage ein paar Straßen weiter, an einer anderen Grundschule, eskaliert. Tagelang standen Kamerateams an der Schultür, um einen Blick auf die sogenannte Deutschenklasse zu erhaschen. Auch an dieser Schule verspricht man den Eltern seit vier Jahren, dass Gruppen geschlossen in eine Klasse kommen können. Auch hier will man so Mittelschichtskinder locken, deren Eltern die Schule gemieden haben. »Die Eltern hatten Angst vor der Schule«, erzählt ein Vater. »Auf den Spielplätzen hat man sich wahre Horrorgeschichten erzählt.« Die Direktorin habe diesen Ängsten, die oft nicht mal begründet gewesen seien, etwas entgegensetzen wollen.
Am ersten Schultag im vergangenen Sommer wurde die Kluft so offenbar, dass die Verwandten einiger Erstklässler sich wehrten: In der A 3 saßen fast nur Mittelschichtskinder, die meisten deutscher Herkunft. In der Parallelklasse, der A 6, waren fast nur Kinder türkischer und arabischer Eltern. Eine gut situierte Klasse, eine arme. Eine helle, eine dunkle.
Das Schulamt wies die Rektorin an, diese Aufteilung rückgängig zu machen. Aber da hatten die neuen Erstklässler ihre erste Lektion schon gelernt: wie man Gräben vertieft.
Katharina von Borcke will das alles eigentlich nicht. Ihre eigene Schule mag sie unterfordert haben, doch im Nachhinein sieht sie auch viel Positives. Sie erzählt von einer polnischstämmigen Nachbarsfamilie, deren Kinder mit ihr in die Schule gingen. Der Vater war Waldarbeiter, die Familie heizte mit Holz. Manchmal stand die kleine Katharina halb erschaudert, halb fasziniert da und sah zu, wie der Vater ein Schwein schlachtete. Die Nachbarn hatten das Spielzeug, das zu Hause verboten war: aus Plastik, mit Lichtern und lauten Tönen. »Ich weiß, dass ich, wie die meisten Eltern hier, meinem Kind solche Erfahrungen verbaue«, sagt sie.
Wenn Hussein Erim sich an seine Schulzeit erinnert, spricht er von Liebe. Es ist ein ungewohntes Wort in einer in Deutschland oft sehr abstrakt geführten Bildungsdiskussion. Hussein Erim glaubt, dass Liebe das alles Entscheidende sei. Als sein Lehrer starb, weinte er lange. Wann immer er in der Türkei ist, fährt er an sein Grab.
»Warum haben Sie Ihren Lehrer geliebt, Herr Erim?«
Hussein Erim streicht sich als Antwort mit der flachen Hand über den Kopf, spitzt die Lippen zu imaginären Küsschen und strahlt. So, sagt er, habe sein Lehrer ihn belohnt, wenn er die Aufgaben richtig gemacht habe. »Gut, mein Sohn«, habe der Lehrer gesagt. »Ich freue mich sehr. Weiter so. So wirst du ein anständiger Herr.«
Wenn sein Sohn Ercan die Hefte vorzeige, sagt Erim, höre der höchstens ein müdes »Hmmm«.
»Der Lehrer ist der Hirte«, sagt Erim. »Er muss lieben und strafen. Aber er darf dem Kind gegenüber doch nicht gleichgültig sein.«
Eine Gruppe, in der nicht alle gleich sein müssen. Ein Lehrer, der liebt und leitet. In diesem Moment scheinen sich Katharina von Borcke und Hussein Erim recht nah zu sein. Es macht wenig Mühe, sich eine Schule zu erträumen, in der beide glücklich sein könnten. Dass es so eine Schule nicht gibt, wird Victor von Borcke den kurzen Schulweg kosten. Ercan und Erkan Erim vielleicht die Chancen auf eine bessere Zukunft.
Schon jetzt ist die erste Weiche gestellt: Das Schuljahr ist zu Ende, die Grundschule vorbei. Von August an werden Erkan und Ercan auf eine Gemeinschaftsschule gehen. Wieder werden sie mit Kindern aus ärmeren Familien, mit Kindern, deren Eltern eingewandert sind, in einer Klasse sitzen. Trotzdem fiebern die beiden dem neuen Schuljahr entgegen. Sie glauben fest daran, dass dann alles besser wird.
Ercan und Erkan Erim scheinen dem deutschen Bildungssystem noch eine Chance geben zu wollen. Man kann nur hoffen, dass sie nicht enttäuscht werden. Dass sie es schaffen, die 33 Meter und 80 Zentimeter breite Kluft zu überwinden.
Dani Mansoor, ein Nachbar von Hussein Erim, hat an diesem Morgen wieder einmal die Scherben zerbrochener Flaschen vor seiner Tür weggefegt. Fast jeden Tag geht in der Siedlung etwas zu Bruch. Wenn die Kinder zwölf, dreizehn Jahre alt seien, so berichten es alle hier, könne man viele nicht mehr erreichen. Sie seien dann nach Jahren der Niederlagen frustriert. »Die Menschen von der anderen Seite«, sagt Mansoor, »die denken, das geht sie nichts an. Aber die Wut breitet sich aus wie ein Virus.«
Einer der Studenten, die die Lernpatenschaften planen, blickt auf den Hof und sagt: »Es heißt immer: Kinder sind unsere Zukunft. Aber die Kinder hier in der Siedlung, die sind mit dem Satz oft nicht gemeint.«
Das könnte das Ende sein. Aber das sollte es nicht. Zu mutlos, zu trist. Das Ende sollte der Moment sein, in dem Ercan Erim tanzt.
Gerade ist er am Berliner Alexanderplatz aus der U-Bahn gesprungen. »Der Eiffelturm, oder?«, hat er gefragt und auf den Fernsehturm gezeigt. Er ist die große Chipperfield-Treppe hochgerannt. »Auf keinen Fall Aufzug fahren!«, hat er gerufen. Und seinem Bruder, der lustlos hinterhertrottete, hat er zugerufen: »Freu dich doch, Erkan, bitte, freu dich doch!« Ercan hat die sieben Seiten mit Aufgaben für die Schnitzeljagd fließend vorgelesen, und jetzt tanzt er, dreht sich im Kreis, klatscht in die Hände und jubelt: »Ist die schön, oder?« Dann kommt er zur Ruhe. Ercan Erim steht vor der Büste der Königin Nofretete und ist froh.
Falsche Anreize
Der deutsche Staat zahlt zu viel Geld direkt an die Familien und investiert zu wenig in eine gute Infrastruktur für die Kleinsten
Die Diagnose ist gestellt. Und jetzt? Ist die Kluft überhaupt zu schließen? Die Bildungsforschung antwortet mit einem »Jein«. Der Staat kann keine Wunder vollbringen, er wird die Unterschiede zwischen armen und reichen, umsorgten und weniger geförderten Kindern nie ganz aufheben können. Aber das Bildungssystem, da sind die Ergebnisse eindeutig, ist mitverantwortlich dafür, wie tief die Kluft ist. Nur in vier anderen Industriestaaten – Belgien, Chile, Türkei und Ungarn – sind die Chancen der Kinder so sehr vom Status der Eltern abhängig wie in Deutschland.
Es gibt Studien, die untersuchen, wie vielen Kindern es gelingt, trotz widriger Umstände gute Leistungen zu erzielen. In Finnland überwinden 46 Prozent der eigentlich benachteiligten Kinder die Kluft, in Deutschland nur 23 Prozent. Was also müsste hier anders laufen?
Mehrere Studien legen nahe, dass der Staat möglichst früh möglichst viel in Bildung investieren müsste. Das Geld sollte vor allem bei denen landen, die keinen günstigen Start hatten. In der US-amerikanischen Kleinstadt Ypsilanti im Bundesstaat Michigan begann 1962 ein inzwischen berühmtes Experiment. Ein Forscherteam teilte Kleinkinder aus den ärmsten Familien der Stadt per Losentscheid in zwei Gruppen ein: Die eine beobachtete man nur; die andere durfte einen kostenlosen Halbtagskindergarten besuchen, ihre Erzieher waren gut ausgebildet, der Betreuungsschlüssel war ideal. 40 Jahre lang verglichen Forscher die Leben jener Kinder, die zwei Jahre lang bestmöglich gefördert wurden, mit denen, die das Pech hatten, nicht in den Kindergarten gelost worden zu sein. Der Wirtschaftsnobelpreisträger James Heckman wertete die Studien aus. Sein Ergebnis: Die geförderten Kinder fanden bessere Jobs, zahlten mehr Steuern, brauchten weniger staatliche Unterstützung, und sie wurden seltener kriminell (siehe auch »Auf die Familie kommt es an«).
Die Kleinstadt Ypsilanti ist weit weg, das Jahr 1962 längst Vergangenheit, doch die Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Allmendinger, kommt nach der Auswertung zahlreicher Statistiken zum selben Fazit: »Erstens, je früher wir im Lebenslauf in Bildung investieren, umso höher sind die Erträge. Die Erträge von früher Bildung sind, zweitens, vor allem für benachteiligte Gruppen hoch.«
Der deutsche Staat setzt mit seiner Bildungs- und Familienpolitik derzeit aber ganz andere Anreize: Er zahlt viel Geld direkt an die Familien und gibt vergleichsweise wenig für eine gute Infrastruktur aus. Kindergeld, Kinderfreibeträge, Elterngeld und Betreuungsgeld – das alles kostet und kommt, entgegen der Forderung vieler Bildungsforscher, nicht in erster Linie denen zugute, die es besonders nötig hätten. »Kinder werden von Geburt an ungleich alimentiert«, schreibt Jutta Allmendinger. »Und zwar nicht entgegen dem Einkommen ihrer Eltern, um so einen Ausgleich zwischen den sozialen Schichten zu schaffen, sondern entsprechend dem Einkommen der Eltern.«
Nur 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts investiert der Staat in Kindergärten. Das ist die Hälfte dessen, was die OECD empfiehlt. Und viel weniger als Länder wie Dänemark (2,1 Prozent), Schweden (1,7 Prozent) und Frankreich (1,2 Prozent) für die frühe Bildung der Kleinsten ausgeben.
Zudem leistet sich Deutschland einen Flickenteppich aus pädagogischen Konzepten und Systemen. Die Bundesländer muten Lehrern und Schülern ständige Reformen zu. Auch das, vermuten Bildungsforscher, schade vor allem schwachen Kindern. Denn sie brauchen starke Erzieher und Lehrer, die sich ihrer Rolle sicher sind. Der Neuseeländer John Hattie wertete 800 Schüler-Studien aus, sein Ergebnis ist eindeutig: Für den Bildungserfolg der Schüler ist der Lehrer entscheidend. Er sollte den Unterricht steuern und klar strukturieren. Und: Er sollte an seiner Haltung arbeiten. Viel zu viele Lehrer machten vor allem ihre Schüler (und deren Eltern) für schleppende Lernfortschritte verantwortlich. Interessanterweise reden viele deutsche Lehrer ihre Bedeutung klein: 48 Prozent antworteten in einer Allensbach-Umfrage, sie hätten wenig oder gar keinen Einfluss auf den Erfolg ihrer Schüler.
Bildungsstudie
Aufwärts oder abwärts?
Viele junge Deutsche sind gebildeter als ihre Eltern – das belegt eine neue Studie. Seltsam nur: Kürzlich behauptete eine andere Studie das Gegenteil.
VON THOMAS KERSTAN UND FRIEDERIKE LÜBKE
DIE ZEIT, 14.02.2013 Nr. 08
Wird Deutschland dümmer? Ist unser Land auf dem absteigenden Ast? Das legte vor Kurzem eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nahe. Sie vermeldete überraschend, dass es in Deutschland mehr Bildungsabsteiger als -aufsteiger gebe. Mit anderen Worten: Der Nachwuchs erlange im Durchschnitt niedrigere Bildungsabschlüsse als die Eltern. Nun zeigt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) das Gegenteil. Wie kann das sein?
Wie rechnet man Deutschland schlecht?
Zwar kann man der OECD nicht vorwerfen, dass sie trickse, wenn sie feststellt, dass es in Deutschland mehr Bildungsabsteiger als -aufsteiger gebe. In ihrem Bericht Bildung auf einen Blick 2012 steht geschrieben, dass 22 Prozent der 25- bis 34-Jährigen über einen niedrigeren Bildungsabschluss als ihre Eltern verfügten, also Bildungsabsteiger seien. Nur 20 Prozent erlangten einen höheren Abschluss, und 58 Prozent einen gleichwertigen.
Aber die OECD hat die für Deutschland ungünstigste Art des Vergleichs gewählt:
Erstens ist der Vergleich verzerrt, weil die Ausbildungszeiten in Deutschland nach internationalem Maßstab noch immer besonders lang sind. Überdurchschnittlich viele der deutschen 25- bis 34-Jährigen haben ihr Studium oder ihre Promotion noch nicht abgeschlossen. Sie haben also nur derzeit einen minderwertigeren Abschluss als ihre Eltern, können aber noch gleichziehen oder sie sogar überholen.
Zweitens bildet die international übliche Eingruppierung der Bildungsabschlüsse die deutsche Wirklichkeit nur unzureichend ab. Sie wurde von der UN-Bildungsorganisation Unesco entwickelt und nennt sich ISCED. Auf Behördendeutsch: Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen. Jeder Bildungsabschluss wird dort in eine Schublade einsortiert. Liegt der Abschluss des Kindes in einer höheren Schublade als der seiner Eltern, darf es sich Bildungsaufsteiger nennen. So weit, so klar. Nur liegen bei der ISCED aber zum Beispiel der Meisterabschluss und der Universitätsabschluss in einer Schublade (ISCED Stufe 5), während Berufsabschlüsse des dualen Systems in der Schublade darunter liegen (Stufe 4). Das hat einen merkwürdigen Effekt: Nehmen wir an, der Vater hat einen Hauptschulabschluss und ist Schuhmachermeister (Stufe 5). Sein Sohn hat Abitur gemacht und eine anspruchsvolle Ausbildung als Fachinformatiker absolviert (Stufe 4) – dann gilt er nach dieser Logik als Bildungsabsteiger. Und auch seine Tochter, die an der Universität ein Mathematikdiplom (Stufe 5) erworben hat, gilt nicht als Bildungsaufsteigerin.
Den Besonderheiten des deutschen dualen Ausbildungssystems wird die ISCED also offensichtlich nicht gerecht.
Drittens wird die Statistik dadurch verzerrt, dass die OECD aus Gründen der Vereinfachung den Abschluss der Kinder nur mit dem höchsten Abschluss der beiden Elternteile vergleicht, meistens ist das bislang der des Vaters. Wenn nun der Vater Akademiker ist und die Mutter keine Ausbildung hat, dann gerät die Tochter, die Bankkauffrau gelernt hat, als Bildungsabsteigerin in die Statistik.
Man kann also, wie die OECD, statistisch sauber arbeiten – und trotzdem ein Zerrbild unseres Landes malen.
Wie rechnet man Deutschland gut?
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat nun – von der Presse kaum beachtet – eine Studie zur Bildungsmobilität vorgelegt, die ein ganz anderes Bild zeichnet als die OECD. »In Deutschland gibt es mehr Bildungsaufsteiger als -absteiger«, heißt es dort. Viele junge Menschen schafften also einen höheren Abschluss als ihre Eltern.
Die IW-Forscher kommen zu diesem Ergebnis, indem sie drei Dinge anders gemacht haben als die OECD-Forscher. Erstens vergleichen sie die 35- bis 44-Jährigen mit ihren Eltern und nicht die 25- bis 34-Jährigen. Damit umgehen sie den Sondereffekt der bisherigen langen Ausbildungszeiten in Deutschland. Zweitens differenzieren sie zwischen Handwerksmeistern und Universitätsabsolventen. Die Diplom-Mathematikerin aus dem obigen Beispiel gilt bei ihnen also als Aufsteigerin. Und drittens vergleicht das IW die Abschlüsse der Kinder getrennt mit denen der Mütter und der Väter.
Im Ergebnis erreicht dann rund ein Drittel des Nachwuchses einen höheren Abschluss als der Vater, nur knapp ein Fünftel einen niedrigeren. Im Vergleich zu den Abschlüssen der Mutter dürfen sich sogar gut 40 Prozent als Bildungsaufsteiger sehen und nur knapp 10 Prozent als -absteiger.
Auch für die Zukunft ist das IW optimistisch, weil zum Beispiel der Anteil der Kinder ungelernter Arbeiter an den 17-jährigen Gymnasiasten zwischen den Jahren 2000 und 2009 von 17 auf 22 Prozent gestiegen sei.
Was sagen andere Studien?
Es gibt neben der OECD-Studie keine relevante Untersuchung, die zu dem Schluss kommt, in Deutschland sei der Bildungsabstieg die vorherrschende Tendenz. Die Autoren des Nationalen Bildungsberichts 2012 etwa errechnen gut 40 Prozent Bildungsaufsteiger gegenüber gut 10 Prozent -absteigern. Dabei unterscheiden sie aber nur zwischen Hochschulabsolventen und Nichthochschulabsolventen.
Auch der Nationale Bildungsbericht notiert eine deutliche Steigerung der Abiturientenquoten. Bei den 30- bis 35-jährigen Männern und Frauen liegt sie bei mehr als 40 Prozent, bei den 60- bis 65-Jährigen nur bei gut 25 Prozent (Männer) beziehungsweise gut 15 Prozent (Frauen). Der Zuwachs an Hochschulabsolventen geht jedoch nur aufs Konto der Frauen. Bei den Männern stagniert ihr Anteil bei gut 20 Prozent, bei den Frauen stieg ihr Anteil von gut 10 Prozent (60- bis 65-Jährige) auf gut 20 Prozent (30- bis 35-Jährige).
Ist also alles gut?
Natürlich nicht. Weiterhin bleibt das Hauptproblem des Bildungssystems: das untere Ende. Zwar ist der Anteil der »Pisa-Verlierer« von knapp einem Viertel auf ein Fünftel gesunken. Aber das ist noch immer eine viel zu große Zahl an 15-Jährigen, die nicht richtig lesen und rechnen können und damit enorme Probleme mit dem Berufseintritt haben, die nicht als qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die sozialen Sprengstoff darstellen. Diese sogenannte Risikogruppe zu minimieren muss endlich in den Mittelpunkt der Bildungspolitik gerückt werden.
Inwiefern die Studentenzahlen noch weiter gesteigert werden müssen, ist selbst unter Fachleuten umstritten. Aber dieser Streit muss geführt werden, um für unser Land eine eigene Bildungsstrategie zu entwickeln und sich nicht einfach – etwa von der OECD – treiben zu lassen.
Eine paradoxe Pointe übrigens hätte ein noch höherer Akademikeranteil an der Bevölkerung: Wenn alle studieren, dann kann es keinen Bildungsaufstieg mehr für den Nachwuchs geben. Es sei denn, als neue Losung wird die »Promotion für alle« ausgegeben.
Welche Statistik hätten Sie denn gern?
Wer Deutschland als Land des Bildungsabstiegs sehen möchte, der halte sich an die Statistik der OECD (Grafik 1). Sie vergleicht die Abschlüsse der 25- bis 34-Jährigen mit dem höchsten Abschluss ihrer Eltern.
Ein optimistischeres Bild zeichnet die Statistik des Instituts der deutschen Wirtschaft (Grafik 2). Sie vergleicht die Abschlüsse der 35- bis 44-Jährigen mit den Abschlüssen ihrer Mütter und mit denen ihrer Väter.


Бесплатный фрагмент закончился.