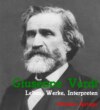Читать книгу: «Giuseppe Verdi. Leben, Werke, Interpreten», страница 2
1826 arbeitete Rossini seinen Maometto II für die Pariser Opéra zu Le Siège de Corinthe um, im Jahr darauf den Mosè in Egitto zu Moïse et Pharaon, ou Le passage de la Mer Rouge. Bei der Ausgestaltung der Gesangspartien nahm er auf die Virtuositätsfeindlichkeit des an die Gluck-Interpreten gewöhnten Pariser Publikums Rücksicht: Die Rollen sind in den französischen Neufassungen weit weniger ausgeziert als in den italienischen Fassungen. Die französischen Kritiker reagierten darauf begeistert: „Endlich“, so der Tenor einiger Besprechungen, „hat sich jemand [nämlich Rossini] gefunden, der die aboyements [Gekeife, Geschrei] der Gluck-Interpreten aus der Opéra verbannt und die Sänger zu stimmlichem Wohlverhalten erzieht“. Gemeint waren jene Sänger, die der sogenannten école du cri [Schule des Schreiens] der Gluck-Tradition angehörten. Nicht einmal Napoleon Bonaparte höchstselbst war es gelungen, den ihm verhaßten cri der Gluckisten auszurotten, obwohl er einmal einige Sängerinnen ebenso unverblümt wie vergeblich aufgefordert hatte: „Meine Damen, würden Sie heute abend etwas weniger schreien als sonst?“
Einem spanischen Musiker, der Rossini 1845 in Bologna besucht hatte und bei dieser Gelegenheit über den Niedergang des Musiktheaters geklagt hatte, schrieb der Meister: „Ihr habt recht, heute geht es nicht mehr darum, wer besser singt, sondern wer mehr schreit. In ein paar Jahren werden wir in Italien keinen einzigen Sänger mehr haben.“[20] Diese Äußerung trifft aus Rossinis Sicht insofern zu, als der kultivierte falsettone-Gesang[21], den Rossini über alles liebte und in seiner Jugend selbst erlernt und betrieben hatte, ausstarb. Auf Rossinis hypersensibles Gehör wirkten die mit Vollstimme gesungenen hohen Töne wie der „Schrei eines Kapauns, dem die Gurgel durchgeschnitten wird“.[22] Als der mit einer ausgezeichneten Höhe gesegnete Tenor Enrico Tamberlick einmal zu Rossini auf Besuch kam, sagte letzterer zu seinem Diener: „Er soll eintreten, aber sein Cis in der Garderobe ablegen. Er kann es dann wieder mitnehmen, wenn er geht.“
1858 hatte sich die Situation für Rossinis Ohren nicht gebessert, im Gegenteil. Bei einem Essen in seiner Villa in Passy, zu dem auch Edmond Michotte[23] eingeladen war, äußerte Rossini zu dem leidigen Thema folgendes:
Leider ist der bel canto nun vollkommen verloren: Es besteht keine Hoffnung mehr auf seine Wiederkehr. Für die Künstler unserer Tage besteht der Gesang in einer konvulsivischen Verzerrung der Lippen, aus denen, besonders bei den Baritonen, tremolierende Töne herauskommen, die dem Dröhnen sehr ähnlich sind, das in meinen Ohren das Schwanken des Fußbodens beim Eintreffen des Karrens meines Bierlieferanten verursacht; gleichzeitig ergehen sich die Tenöre in lautem Geschrei und die Primadonnen in gurgelnden Geräuschen, die mit der wahren Stimmgebung und den Roulades außer den Reimen[24] nichts gemein haben. Ich spreche gar nicht von den Portamenti der Stimme, von dieser Art Eselsgeschrei, das von der Höhe in die Tiefe gleitet, und von dem Trompeten der Elefanten, das von der Tiefe in die Höhe fährt. Die Natur erschafft bedauerlicherweise kein ganz vollkommenes Organ, es ist deshalb erforderlich, daß der künftige Sänger das Instrument, dessen er sich bedienen muß, selbst aufbaut. Und wie lang und schwierig ist diese Arbeit! In vergangenen Zeiten half man dem Fehler der Natur dadurch ab, daß man Kastraten herstellte. Diese Methode erforderte zwar Heldenmut, aber die Ergebnisse waren wunderbar. Ich erinnere mich, den einen oder anderen in meiner Jugend gehört zu haben: Die Reinheit, die ans Wunderbare grenzende Flexibilität dieser Stimmen, und vor allem die zu Herzen gehenden Töne bewegten und faszinierten mich so sehr, daß ich es gar nicht auszudrücken vermag.[25]
Beinahe zur gleichen Zeit meldete sich Giuseppe Verdi zu dem Thema zu Wort: „Die Frauen wie die Männer sollen singen und nicht schreien: Sie sollen daran denken, daß vortragen nicht brüllen bedeutet! Wenn man in meiner Musik nicht viele Vokalisen findet, darf man sich deswegen nicht die Haare raufen und wie Besessene toben.“[26]
Außer den Beschwerden über schreiende Sänger gab es teilweise recht deftig formulierte Klagen über andere Sängermankos, geäußert von unbezweifelbar kompetenten Experten wie zum Beispiel Gaetano Donizetti. Als er im Juni 1844 am Wiener Kärntnertortheater die Generalprobe seines Roberto Devereux besuchte, mußte er nolens volens das Weite suchen: „Ich habe mir bei der letzten Probe zwei Akte in einer Loge angehört, den dritten hielt ich nicht mehr aus – es gab zu viele falsche Noten, Rollenunkenntnis, mangelndes Spiel etc. Man sagt mir, daß gestern alles noch schlimmer gewesen sein soll.“ Und über die Premiere: „Die Montenegro[27] hatte jedes nur erdenkliche Pech: Sie begann sogar eine Phrase eine Terz zu tief, unterbrach sich in der Mitte und setzte eine Terz höher wieder ein. Die falschen Noten, die gestern von ihr, von Ronconi und von Varesi produziert wurden, sind unbeschreibbar.“[28] Und, im selben Brief: „Es tut mir leid wegen der Montenegro. [...] Aber, bei Gott!, wenn diese arme Frau beim Singen nicht richtiger intoniert und dabei einen weniger schiefen Mund macht, wird es schwer sein, daß sie gefällt. Sie hat kein Solfège studiert und hat kein gutes Gedächtnis; sie hat Gefühl, aber ihr Gefühl kann sich keinem Rhythmus anpassen.“
Ähnliche Probleme hatte offenbar die berühmte Eugenia Tadolini[29], die gegen Verdis Willen 1848 in Neapel die Lady Macbeth sang. Über sie wußte Donizetti zu berichten: „Sie hatte eine Stimme wie eine alte Zikade, machte Fehler, unterbrach sich und war schrecklich.“ Auch der gefeierte Tenor Napoleone Moriani[30], der in Italien als „tenore della bella morte“ – der Tenor mit den schönen Sterbeszenen – bekannt war, blieb nicht verschont. Dieser hätte nach Donizettis Wunsch bei seinen Auftritten öfter „gut bei Stimme sein und den guten Willen haben [müssen], nicht immer, aber wenigstens manchmal allegro zu singen. Was die Seele anlangt, so haben er und die Primadonna davon soviel wie ein Spatz.“[31]
Felix Mendelssohn Bartholdy äußerte sich über die berühmte Giuditta Pasta, Bellinis erste Amina (La sonnambula) und Norma sowie Donizettis erste Anna Bolena, folgendermaßen:
Neulich hörte ich die Pasta in der Semiramide. Sie singt jetzt, namentlich in den Mitteltönen, so fürchterlich falsch, daß es eine wahre Qual ist; dabei sind natürlich die herrlichen Spuren ihres großen Talents, die Züge, die eine Sängerin ersten Ranges verrathen, oft unverkennbar. In einer andern Stadt würde man das schreckliche Detoniren erst empfunden und nachher überlegt haben, daß dies die große Künstlerin sei; hier sagte sich jeder vorher, dies sei die Pasta, sie sei alt, sie könne daher nicht mehr rein singen, man müsse also davon abstrahiren. So würde man sie anderswo vielleicht ungerechterweise herabgewürdigt haben; hier war man ungerechterweise entzückt, und zwar mit voller Refexion, mit Bewußtsein des Drüberstehens entzückt. Das ist ein schlimmes Entzücken.[32]
Dieser vom 23. August 1841 stammende Kommentar berichtet über die erst 43jährige Sängerin, die sich wegen ihrer seit ungefähr 1837 bestehenden stimmlichen Probleme im Vorjahr von der Bühne zurückgezogen hatte, jetzt aber gezwungen war, wieder aufzutreten, weil sie dank einer unfähigen Wiener Bank fast ihr ganzes Vermögen verloren hatte. Die von Mendelssohn als „alt“ empfundene, für heutige Begriffe aber durchaus junge Künstlerin hatte ihre Probleme in der Mittellage vermutlich durch den Wechsel vom Mezzosopran- ins Sopranfach verursacht.
Eine wenig bekannte, plastische Beschreibung Giuditta Pastas verdanken wir George Sand[33]:
Auf der Bühne erschien die Pasta noch immer jung und schön. Sie war klein, dick und hatte zu kurze Beine, wie viele Italienerinnen, deren herrliche Büste nicht zu den übrigen Körperverhältnissen paßt. Aber dennoch gelang es der Künstlerin durch den Adel ihrer Bewegungen und die Feinheit ihrer Gestikulation groß und majestätisch zu erscheinen. Ich war sehr unangenehm überrascht, als ich ihr am folgenden Tage begegnete. Sie stand in ihrer Gondel und war mit jener übertriebenen Sparsamkeit gekleidet, welche die Hauptsorge ihres Lebens geworden war. [...] in ihrem alten Hut und Mantel hätte man die Pasta für eine Logenschließerin halten können. Als sie jedoch eine Bewegung machte, um dem Gondelführer den Platz zu bezeichnen, wo sie landen wollte, lag darin die ganze Majestät der Königin oder Göttin.[34]
Zitate wie jenes von Felix Mendelssohn Bartholdy könnte man beinahe beliebig fortsetzen. Sie finden sich auch bei anderen nicht-italienischen Komponisten wie zum Beispiel bei Franz Liszt, der 1838 oft die Mailänder Scala besuchte und sich danach abfällig über Berühmtheiten wie die Schoberlechner[35] oder die Brambilla[36] äußerte. Eines wird aus all diesen Klagen klar: daß die bei Opernliebhabern – einer Species, die mit jener der Musikliebhaber nur entfernt verwandt ist – weit verbreitete Annahme, es habe einmal ein „Goldenes Zeitalter“ des Gesanges – zum Unterschied von den Goldenen Zeitaltern der Kunstform Oper – gegeben, dessen unwiederbringlicher Verlust zu beklagen sei, oft mehr auf eine subjektive Empfindung als auf eine nachweislich bestehende Realität zurückzuführen ist. Die bis heute gerne mit dem Epitheton „legendär“ ausgestatteten Sänger dieser obskuren mythischen Epoche hätten demnach Wunder an überwältigender Stimmschönheit, vollendeter Gesangstechnik, raffiniertester Eloquenz der Interpretation, höchster Musikalität, ausgeprägtem Stilgefühl, erlesenstem Geschmack, raumfüllender Bühnenpräsenz, überbordendem schauspielerischen Talent und derlei Qualitäten mehr gewesen sein müssen. Mit einem Wort, sie müssen in jeder Hinsicht besser als alles gewesen sein, was in späteren Jahren zu hören war.
Wenn man derlei Äußerungen allerdings näher betrachtet, stellt sich zumeist heraus, daß das jeweilige Goldene Zeitalter entweder in die Prägungsphase der ersten jugendlichen Begeisterung des Betreffenden für die Oper (Abteilung: Verklärte Jugenderinnerungen) fällt, oder aber eine oder zwei Generationen zurückliegt, je nachdem, ob das Hörensagen von der Generation der opernbegeisterten Eltern oder Großeltern des Verherrlichers verlorener Größe herstammt. Es ist Aufgabe der Psychologen und Soziologen, zu erklären, was es mit dem verbreiteten Phänomen der Schaffung von Mythen, Helden und Göttern und deren Anbetung auf sich hat. Und weshalb „früher“ vieles oder sogar alles „besser“ war.
Selbst Gesangsdarbietungen im privaten Bereich evozierten die Nostalgie nach der Kunst vergangener Tage. George Sand, eine realitätsbezogene Kämpfernatur mit hellsichtigem Intellekt, nimmt diesen Standpunkt ein, wenn sie in ihren Lebenserinnerungen unter Bezugnahme auf die Schwester ihrer Urgroßmutter berichtet:
Literatur und Musik waren die einzige Beschäftigung dieses Kreises. Aurora war von engelhafter Schönheit; ihr Verstand war ausgezeichnet; durch die Gründlichkeit ihrer Bildung stand sie den aufgeklärtesten Geistern ihres Zeitalters gleich. Ihre Fähigkeiten wurden durch den Umgang, die Unterhaltung und die Umgebung ihrer Mutter noch entwickelt und ausgebildet. Überdies hatte sie eine prächtige Stimme, ich habe nie eine bessere Musikerin gekannt. Man gab auch komische Opern bei Ihrer Mutter; sie machte Colette im Devin du village[37], Azemia in den Sauvages[38] und alle Hauptrollen in den Stücken Gretry’s und Sedaine’s. In ihrem Alter habe ich sie hundert Mal die Melodien alter italienischer Meister singen hören, die sie zu ihrer Hauptnahrung erkoren hatte, wie Leo, Porpora, Pergolesi, Hassa[39] u.s.w. Ihre Hände waren gelähmt, sie begleitete sich mit zwei oder drei Fingern auf einem alten, kreischenden Klaviere: ihre Stimme zitterte, war aber immer richtig und umfangreich, und Schule und Vortrag verlieren sich nie. Sie las alle Partitionen[40] vom Blatte und ich habe niemals besser singen oder begleiten gehört. Sie hatte jene großartige Manier, jene breite Einfachheit, jenen reinen Geschmack, jene Klarheit der Betonung, die man nicht mehr hat, die man heut zu Tage nicht einmal kennt.[41]
Seit jeher waren auch große Teile des Publikums, genau wie die oben zitierten Musiker, mit dem „Früher war alles besser“-Bazillus infiziert. Als beispielsweise der später allseits vergötterte Tenor Enrico Caruso seine ersten Auftritte an der New Yorker Metropolitan Opera absolvierte, wurde er von Publikum und Kritik mit dem abschätzigen Vorwurf konfrontiert, er könne seinem Vorgänger Jean de Reszke nicht das Wasser reichen. Auch das ist ein Phänomen der Opernwelt: Erfolgreiche Sänger werden seit Orpheus’ Zeiten mit gekrönten, regierenden Häuptern gleichgesetzt und müssen derohalber zwangsweise „Nachfolger“ haben oder sein, und zwar indem sie „ein(e) neue(r) ...“ sind. An die Stelle der Punkte kann man in der Musikgeschichte beliebige Namen setzen, von Farinelli bis Rubini, Duprez, Fraschini, Bonci, Patti, Caruso, Ruffo, Schaljapin oder Callas.
Die Erforschung und Dokumentation der historischen Realität dieser sagenhaften Goldenen Zeitalter, in denen Publikum und Autoren aus der Sicht mancher heutiger Opernbegeisterter sich wohl gleichermaßen in einem ständigen Begeisterungsrausch befunden haben müssen, erscheint nicht nur aus den genannten Gründen von Interesse, sondern auch, wenn man liest, wie Giuseppe Verdi, jener italienische Komponist, der wie kein anderer den Höhepunkt der italienischen Opernkunst im 19. Jahrhundert (wiederum ein Goldenes Zeitalter) personifiziert, die Opernhäuser seiner Zeit und deren Personal beurteilte:
Das Repertoiretheater wäre eine ausgezeichnete Sache, aber ich halte es nicht für realisierbar. Die Beispiele der Opéra und Deutschlands[42] haben für mich sehr wenig Wert, weil die Aufführungen in all diesen Theatern beklagenswert sind. In der Opéra ist die mise en scène hervorragend, an sorgfältiger Ausstattung und gutem Geschmack ist sie allen Theatern überlegen, aber der musikalische Teil ist miserabel. Immer höchst mittelmäßige Sänger (seit ein paar Jahren mit Ausnahme von Faure[43], Orchester und Chor lustlos und ohne Disziplin. Ich habe in dem Opernhaus Hunderte von Vorstellungen gehört, kein einziges Mal eine musikalisch gute. Aber in einer Stadt mit 3.000.000 Einwohnern finden sich immer zweitausend Personen, die den Zuschauerraum auch bei einer schlechten Vorstellung füllen.
In Deutschland sind die Orchester und Chöre aufmerksamer und gewissenhafter; sie spielen genau und gut; dennoch habe ich in Berlin klägliche Vorstellungen gesehen. Das Orchester ist grob und klingt grob. Der Chor nicht gut, die mise en scène ohne Charakter und ohne Geschmack. Die Sänger ... oh, die Sänger schlecht, absolut schlecht. Ich habe dieses Jahr in Wien die Meslinger[44] (ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig schreibe) gehört, die als die Malibran[45] Deutschlands gilt. Gott im Himmel! Eine jämmerliche und ausgesungene Stimme; geschmackloser und unziemlicher Gesang, annehmbares Spiel. Unsere drei oder vier Primadonnen von Ruf sind ihr, was Stimme und Gesangsstil anbelangt, unendlich überlegen und spielen mindestens ebenso gut.
In Wien (das ist heute das erste Theater Deutschlands) liegen die Dinge besser, was Chor und Orchester (beides hervorragend) anbelangt. Ich habe mehrere Vorstellungen gehört und die Leistungen von Chor und Orchester sehr gut gefunden, die mise en scène aber mittelmäßig, und Sänger, die unter dem Mittelmaß waren; die Vorstellungen kosten aber gewöhnlich wenig; das Publikum (man läßt es während der Vorstellung im Dunkeln sitzen[46]) schläft und langweilt sich, applaudiert am Ende jedes Aktes ein bißchen und geht nach Schluß der Vorstellung nach Hause, ohne Unbehagen und ohne Begeisterung. Und das mag für diese nordischen Naturen ausreichen; aber bringe mal eine ähnliche Vorstellung in eins von unseren Opernhäusern, und Du wirst sehen, was Dir das Publikum für Symphonien komponiert! Unser Publikum ist zu erregbar und würde sich nie mit einer Primadonna wie in Deutschland zufriedengeben, die achtzehn- oder zwanzigtausend Gulden im Jahr bekommt. Wir brauchen Primadonnen, die nach Kairo, Petersburg, Lissabon, London usw. für 25000 bis 30000 Francs im Monat gehen, aber wie soll man die bezahlen? An der Scala haben sie dieses Jahr eine Truppe, wie man sie besser nicht finden kann. Eine Primadonna, die eine schöne Stimme hat, gut singt, äußerst lebendig ist, jung, schön, und noch dazu eine der Unseren. Einen Tenor, der vielleicht der erste ist, bestimmt aber unter den allerersten. Einen Bariton, der nur einen einzigen Rivalen, Pandolfini, hat. Einen Baß, der keinen Rivalen hat. Und trotzdem macht das Theater nur magere Geschäfte. Letztes Jahr sprach man sehr gut von der Mariani! Dieses Jahr begann man zu sagen, daß sie ein bißchen müde sei (notabene das ist nicht wahr).
Jetzt sagt man, daß sie gut singt, aber das Publikum nicht anzieht etc. ... etc. ... wenn sie nächstes Jahr zurückkäme, würden alle sagen ... oh, immer dasselbe etc. etc. Ich erinnere mich, in Mailand einen gewissen Villa gekannt zu haben, einen alten Impresario aus der Zeit, in der Lalande, Rubini, Tamburini und Lablache[47] an der Scala waren, der mir sagte, daß das Publikum nach [anfänglich] großer Begeisterung Rubini schließlich auspfiff und nicht mehr ins Theater ging, so daß die Impresa[48] eines Abends ganze sechs Billette verkaufte!! Unglaublich!! Jetzt frage ich Dich, ob bei unserem Publikum eine ständige Truppe wenigstens drei Jahre lang möglich ist! Und weißt Du, was eine Truppe, wie sie jetzt an der Scala ist, jährlich kosten würde? Der Mariani kann es wohl Vergnügen machen, an der Scala eine Saison lang für 45000 oder 50000 Francs zu singen, aber wenn man ihr einen Jahresvertrag böte, würde sie natürlich eine Monatsgage von 15000 Francs verlangen, wie sie im Ausland 25 oder 30 verdienen kann. Ebenso ein Tenor ... etc. etc. Oh, mein Gott, was für ein langer Brief! Ich hätte Dir viele, viele andere Sachen zu sagen, aber zu dem, was ich Dir gesagt habe, wirst Du den Rest stillschweigend ergänzen.[49]
1875 interviewte eine Musikzeitschrift Verdi anläßlich der Aufführungen der Messa da requiem und der Aida in Wien zweimal zu Fragen des Gesanges:
Ueber Sänger hat Verdi seine eigenen Ansichten. „An Stimmen fehlt es gewiß nicht in Deutschland“, sagt er, „sie sind beinahe klangvoller als die italienischen, die Sänger aber betrachten den Gesang als eine Gymnastik, befassen sich wenig mit der Ausbildung der Stimme und trachten nur in der kürzesten Zeit ein großes Repertoire zu erhalten. Sie geben sich keine Mühe, eine schöne Schattirung in den Gesang zu bringen, ihr ganzes Bestreben ist dahin gerichtet, diese oder jene Note mit großer Kraft hervorzustoßen. Daher ist ihr Gesang kein poetischer Audruck der Seele, sondern ein physischer Kampf ihres Körpers.[50]
Ein Wiener Reporter, welcher Verdi heimsuchte, erzählt Folgendes: Der Maestro sprach voll Lobes vom Chor und Orchester unserer Oper. „Ich habe selten so viele jugendkräftige Stimmen zusammen gehört. Der Chor ist bewunderungswürdig, der beste, der mir noch vorgekommen.“ Wir sprachen von den Sängern, die dem Requiem zu so glänzender Aufnahme verholfen haben. „Einen Theil der Ehre“, sagte Verdi, „kann Oesterreich für sich in Anspruch nehmen, die Damen gehören ja zu Euch.[51] Indessen“, corrigirte er sich fein lächelnd, „ganz können wir sie Euch doch nicht überlassen, die Art, wie sie singen, ist italienisch. Das haben sie bei uns gelernt.“ Ich stimmte bei. „Sehen Sie“, fuhr Verdi fort, „man ist gegen die italienischen Sänger manchmal ungerecht, wenn man ihnen vorwirft, daß sie dem bel canto, dem Gesang zuliebe, das Spielen vernachlässigen. Wie viele Sänger giebt es denn, die beides vereinigen, spielen und singen können? In der komischen Oper ist beides leicht vereint. Aber in der tragischen! Ein Sänger, der von der dramatischen Action ergriffen ist, dem jede Fiber seines Körpers bebt, der ganz aufgeht in der Rolle, die er schafft, der wird den rechten Ton nicht finden. Vielleicht eine Minute lang, in der nächsten halben Minute singt er schon falsch oder die Stimme versagt. Für Action und Gesang ist selten eine Lunge stark genug. Und doch bin ich der Meinung, daß in der Oper die Stimme vor Allem ein Recht hat, gehört zu werden. Ohne Stimme giebt es keinen rechten Gesang.“[52]
Bei der Beurteilung der Sänger, der von ihnen verursachten Krisen der Gesangskunst und deren anscheinend irreversiblem Verfall ist ein Faktum von herausragender Bedeutung: Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sangen die Sänger überwiegend zeitgenössische Musik. Sie sind in diesem Sinne also als Spezialisten zu betrachten. Viele Klagen über Sänger sind deshalb primär unter dem Gesichtspunkt eines sich verändernden Kompositions- und Vortragsstils zu verstehen, dem sich diese anzupassen hatten. Ein Extremfall für Anpassungsprobleme an einen neuen Stil war Adolphe Nourrit (Paris 1802 – Neapel 1839). Er war fünfzehn Jahre lang der erste Tenor der Pariser Opéra, ein kultivierter falsettone-Sänger, der nach dem Auftauchen von Gilbert-Louis Duprez (Paris 1806 – Poissy 1896), einem Tenor, der zu seiner Zeit als Brachialsänger empfunden wurde und der – gesangshistorisch nicht ganz korrekt – als der Erfinder des mit Bruststimme gesungenen hohen C bezeichnet wird, nach Italien ging, um seine Gesangsmethode auf diesen vom Publikum bejubelten neuen Stil umzustellen. Angesichts der Erfolglosigkeit seiner Versuche beging Nourrit Selbstmord.[53]
Als Beispiel für das Repertoire eines berühmten Sängers der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts möge der Tenor Giovanni Battista Rubini (Romano Bergamasco 1794 – 1854) dienen. Der mit einem formidablen musikalischen Gedächtnis ausgestattete Sänger trat im Laufe seiner Karriere in 156 Rollen in Opern von 59 Komponisten auf. Darunter befanden sich zahlreiche Uraufführungen von Werken, deren Hauptrollen eigens für ihn komponiert worden waren. Die in seinem Repertoire meistvertretenen Komponisten sind Bellini (8 Opern), Donizetti (14), Fioravanti (5), Generali (4), Mayr (11), Mercadante (6), Mosca (5), Pacini (9), Paër (4), Raimondi (4), Rossini (20 Opern, 2 Kantaten)[54], allesamt Musiker, die zum Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens Rubinis in der jeweiligen Rolle noch am Leben waren, also zeitgenössische, „moderne“ Autoren. Als Rubini 1815 den Ferrando in Mozarts Così fan tutte, 1831 den Don Ottavio in Don Giovanni oder 1821 den Uriel in Haydns Schöpfung sang, Werke „alter“ Autoren, war dies eher ungewöhnlich.[55] Selbstverständlich differierten auch die Kompositionsstile und die vokalen Anforderungen der Werke, die Rubini im Repertoire hatte, doch schrieben ihre Komponisten sie alle in Kenntnis und unter Berücksichtigung der stimmlichen Konstitution und technischen Möglichkeiten ihres Interpreten (so schrieb Bellini „seinem“ Tenor Rubini viele Partien „in die Kehle“).
Im Gegensatz dazu sehen sich heutige Sänger mit der beinahe unlösbaren Aufgabe konfrontiert, Gesangsstilen von Monteverdi bis Reimann zu entsprechen. Die Folge davon können zwei Phänomene sein: einerseits Sänger, die mehr oder minder die ganze Palette des Repertoires abdecken (müssen) und dabei nicht allen Interpretationsstilen wirklich gerecht werden können, und andererseits Sänger, die sich auf eine Epoche oder einen Kompositionsstil spezialisieren und deshalb bewußt auf Musik mehrerer Jahrhunderte verzichten.
Daß Klagen über stilistische Unzulänglichkeiten zutreffend nur über die erste Gruppe von Interpreten geäußert werden können, versteht sich von selbst. Wenn Rossini, Bellini, Donizetti, Pacini oder Mercadante mit dem gesangstechnischen und stilistischen Rüstzeug eines Mascagni-Interpreten gesungen wird, oder Verdi mit jenem eines Purcell- oder Händel-Sängers – all dies möglicherweise noch mit Aussprache-, Betonungs- oder Phrasierungsfehlern garniert, die aus Unkenntnis der gesungenen Sprache gemacht werden –, mag das von unerfahrenen und ahnungslosen Zuhörern hingenommen werden, ist aber im Sinne der betroffenen Komponisten inakzeptabel. Die in diesen Fällen gerne ins Treffen geführte „Universalität“ und „Internationalität“ der Musik, mit der solche Mängel kaschiert werden sollen, führt sich bei der Lektüre des Briefwechsels zwischen Komponisten und Librettisten ad absurdum und entlarvt sich dabei rasch als Festrednergeschwätz. Es wird nämlich ersichtlich, daß die Mühe und skrupulöse Gewissenhaftigkeit, die die Autoren – im vorliegenden Fall Verdi und seine Textdichter – auf ihre Arbeit verwandten, selbstredend für ein Publikum unternommen wurde, das demselben Kulturkreis wie sie selbst angehörte, wie Verdi im Gespräch mit dem Orientalisten Italo Pizzi selbst formulierte:
Die Kunst muß nationalen Charakter haben; die Wissenschaft nicht. Aber die Italiener sind Italiener und die Musik für die Italiener muß italienisch sein. Wir sind anders als die Deutschen, und noch mehr als die Franzosen (und er betonte diese Worte) und die Russen, und wir haben eine andere Weise zu fühlen.[56]
Libretto- und Musiksprache sowie szenische Umsetzung der Werke waren im 19. Jahrhundert – im Gegensatz zu heute – auf allgemeines Publikumsverständnis ausgerichtet und setzten eine gewisse Bildung und die Kenntnis der Sprache, in der gesungen wurde, voraus. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 1869 auf die rund 21 Millionen zählende Bevölkerung Italiens 17 Millionen Analphabeten[57] entfielen: Verdis Werke waren in einer Weise populär, die heute kaum mehr vorstellbar ist (selbst in den 1950er Jahren konnte man in Italien noch Bauarbeiter bei der Arbeit Verdi-Arien singen hören). Darüber hinaus wurde das Publikum, dem eine Vorbereitung auf das Stück ermöglicht werden sollte, über das zur Aufführung gelangende Werk informiert: Zu diesem Zweck wurden bei den Vorstellungen die Libretti der Opern in der jeweils gespielten Fassung verkauft. Diese jeweils aktuellen Textbücher berücksichtigten alle musikalischen und/oder textlichen Änderungen, Kürzungen, Striche oder Hinzufügungen der jeweiligen Aufführungsserie; sie stellen daher für die Musikwissenschaft wichtige aufführungsgeschichtliche Dokumente dar.
Da die Oper nicht nur in Italien erfunden, sondern dort auch zur Hochblüte gebracht wurde und in ihrer Breitenwirkung am erfolgreichsten war[58], erscheint es zielführend, die Wechselwirkungen zwischen Komponisten und Interpreten anhand eines italienischen Komponisten darzustellen. Die ausführlichsten Äußerungen über Gesangssolisten und sonstige Interpreten sowie über Fragen der Theaterpraxis finden sich in der Korrespondenz Giuseppe Verdis mit seinen zahlreichen Briefpartnern. Diese Dokumente decken einen Zeitraum von rund sechzig Jahren ab und sind als völlig unbeschönigte Aussagen zu werten, da Verdi beim Verfassen seiner Briefe nicht mit deren Veröffentlichung liebäugelte, im Gegenteil. Doch auch gegen seinen Willen greift die Musikforschung zwangsläufig auf diese Dokumente zurück und hält es mit Johann Wolfgang von Goethe: „Von bedeutenden Männern nachgelassene Briefe haben immer einen großen Reiz für die Nachwelt, sie sind gleichsam die einzelnen Belege der großen Lebensrechnung, wovon Thaten und Schriften die vollen Hauptsummen darstellen“[59], ein Gedanke, dem sich auch Arnold Schönberg anschloß: „Erstens ist bei einem großen Menschen nichts Nebensache. Eigentlich ist jede seiner Tätigkeiten irgendwie produktiv. In diesem Sinne hätte ich sogar Mahler zusehen wollen, wie er eine Krawatte bindet, und hätte das interessanter gefunden und lehrreicher, als wie irgendeiner unserer Musikhofräte einen „heiligen Stoff“ komponiert.“[60]
Ein weiterer unschätzbarer Vorteil bei Verdis Äußerungen über seine Interpreten liegt in dem Umstand, daß Tondokumente etlicher von ihm geschätzter Sänger, darunter solche von Uraufführungen, vorliegen, anhand derer man die Urteile des Komponisten und seiner Mitarbeiter mit der akustischen Realität vergleichen kann.
Vorwegnehmend kann ganz allgemein gesagt werden, daß sich bei den Sängern über die Jahrhunderte hinweg kaum etwas geändert hat: Überragendes Talent, höchste Interpretationsintelligenz, fabelhaftes gesangstechnisches Können, grandiose stimmliche Voraussetzungen, wunderbare Musikalität, aber auch Eitelkeit, gepaart mit pomadiger Selbstgefälligkeit und dreister Selbstüberschatzung, intellektuelles und bildungsmäßiges Elend, musikalische und gesangstechnische Inkompetenz, dumpfes Unverständnis dem Beruf gegenüber, die Gesangsleistung beeinträchtigende Geldgier, alles ist schon dagewesen und war und ist wohl auch zum Teil als Reaktion der Betroffenen auf die Haltung der Gesellschaft ihnen gegenüber zu verstehen, von welcher sie entweder als Zieraffen vorgeführt oder als Götter angebetet wurden und werden. Kurz gesagt: Gut und schlecht gesungen wurde zu allen Zeiten.[61] Aber auch: Darstellungs-, Interpretations- und Gesangstalent hängt mit Intellekt und Bildung nur lose zusammen. Und eines darf man nicht vergessen: Singen kann man nicht wollen, singen muß man müssen. Soll heißen: Eine Sängerkarriere kann man nicht wie eine Beamtenkarriere anstreben und durchlaufen, sondern man muß, im Besitz der erforderlichen physischen Voraussetzungen, den ausgeprägten Drang, ja den unwiderstehlichen Zwang verspüren, sich auf diese Weise mitzuteilen und die beträchtlichen Risiken dieses Berufs auf sich zu nehmen.
Der Anteil des Phonationsorgans an einer erfolgreichen Sängerkarriere ist relativ gering. Den überwiegenden Anteil haben Gesangstechnik, Musikalität, Rhythmusgefühl, Stil- und Sprachkenntnis, Sensibilität, Eloquenz, Phantasie, Interpretations- und Kommunikationstalent (Singen hat vor allem mit Kommunikation zu tun), Fleiß, Intelligenz, ständig weitergeführtes Studium (nicht nur reines Rollenstudium), Selbstkritik, die Bereitschaft, objektive, lobhudeleifreie Kritik von Personen des Vertrauens anzunehmen, hohe physische und psychische Belastbarkeit, gutes Gedächtnis, Reiselust inklusive der Bereitschaft, Wochen und Monate auch fern der Familie (in zumeist lauten Hotels) aus dem Koffer zu leben, die Fähigkeit zur richtigen Rollenauswahl, die Stärke, zu Angeboten auch öfter nein zu sagen, Konfliktbereitschaft, auch Glück. Kurzum: Ein Stimmbesitzer ist noch lange kein Sänger.