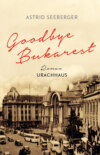Читать книгу: «Goodbye, Bukarest», страница 2
Auf der Insel, 22. Dezember 2014
Wir saßen in der Küche beim Frühstück. Ich sagte, es sei jetzt exakt fünfundzwanzig Jahre her, dass das rumänische Volk sich gegen Ceauşescu erhoben habe. Genau am 22. Dezember war der Diktator in Panik aus Bukarest geflohen. Und die große Stille der Stadt füllte sich mit Musik. Überall spielte man Weihnachtsmusik, die all die Jahre verboten war. Vielleicht hatte ja auch Bruno »Stille Nacht« vor sich hin gesummt, während er auf einem Bahnsteig der U-Bahn auf den Zug wartete.
»Du gibst nicht auf«, sagte Lech.
»Nein«, sagte ich. »Ich will Bruno finden, auch wenn ich nicht weiß, wie.«
»Du hast keine Spur«, sagte er.
»Falls Monsieur Bartier Jeannots Annonce nicht eine Spur ist«, erwiderte ich.
»Vielleicht hat sie deine Mutter auf die Idee gebracht, selber zu annoncieren«, meinte Lech.
Ich sah ihn an. Er war gerade im Begriff, dem Ei mit dem Messer die Spitze abzuschlagen. Ich kannte niemand anderen, der das so elegant machte wie er. Und es waren auch nur wenige, die so scharf dachten.
»Du kannst recht haben«, sagte ich.
Er erwiderte, das sei jedenfalls eine einleuchtende Hypothese.
Auf der Insel, 1. Januar 2015
Lech schlief noch, als ich aufwachte, auch als ich seinen Fuß mit meinem berührte. Aus der Küche waren Geräusche zu hören. Das musste Anselm sein, unser alter Freund, der mit uns Silvester gefeiert hatte. Er wird gewöhnlich früh wach, selbst wenn er spät ins Bett gegangen ist.
Ich dachte an das, was Anselm gestern erzählt hatte. Nach dem Essen hatten wir auf den Sofas Platz genommen, Lech und ich auf dem mit dem Wolfspelz und Anselm auf dem anderen. Lech sagte, jeder Jahreswechsel mache ihm zu schaffen, sie hätten etwas von Memento mori an sich. Während ich sagte, jedes Jahr könne ein Annus mirabilis werden, ein Jahr der Wunder. Da hatte Anselm uns von einem Wunder erzählt.
Eigentlich jedoch sei es die Geschichte einer Besessenheit, sagte er. Arnold Schultze, 1875 in Köln geboren, war Offizier geworden, vielleicht in erster Linie, um in die Kolonien zu gelangen. Denn in den Kolonien gab es das, wovon er besessen war, Pflanzen und Schmetterlinge, die noch niemand beschrieben hatte. Er nahm an der deutsch-englischen Grenzexpedition im nördlichen Kamerun teil, bei der er jede freie Minute darauf verwandte, Schmetterlinge zu sammeln. Dann aber wurde er krank, so krank, dass er das Militär verlassen musste. Das war das Beste, was ihm hatte passieren können. Denn jetzt konnte er sich seiner Besessenheit hundertprozentig widmen. Vielleicht war es ja sogar so, dass ihn diese Besessenheit wieder gesunden ließ.
Er nahm an Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburgs zweiter deutscher Expedition nach Zentralafrika teil. Fuhr nach Kolumbien, wo er sich in den 1920er-Jahren acht Jahre lang aufhielt und eine Arbeit nach der anderen über seine Schmetterlingsfunde verfasste. Und über die Zerstörung des Regenwaldes, vor der er bereits damals warnte. Später dann, nach Abstechern in den Kongo und auf die Balearen, war er zu einer neuen großen Expedition bereit. Und brach mit Hertha, seiner zweiten Frau, nach Ecuador auf. Dort wollte er die Schmetterlinge und Pflanzen erfassen, insbesondere die des Regenwaldes. All das, was dort emporrankte und flatterte, war von so überwältigender Schönheit. Und am wundervollsten war es, all das zusammen mit Hertha zu sehen.
Sie verbrachten fünf Jahre in Ecuador. Fünf Jahre im Paradies, mit einem erstaunlichen Fund nach dem anderen. Dann fuhren Hertha und er heim, zusammen mit einer phänomenalen Sammlung seltener Pflanzen und Schmetterlinge. Am 25. August 1939 gingen sie an Bord des deutschen Handelsschiffes Inn, das nach Hamburg zurückkehren sollte, beladen mit Holz, zweihundertfünfzig Tonnen Gummi und fünfhundert Tierhäuten. Und mit Schultzes Sammlung, die ihn berühmt machen sollte.
Doch hatten sie nicht mit der Weltgeschichte gerechnet. Am 3. September 1939 erklärten Großbritannien und Frankreich Nazideutschland den Krieg. Und die Alliierten verhängten eine Blockade über den Atlantik. Am 5. September wurde die Inn von einem britischen Kriegsschiff gestoppt. Alle an Bord durften das Schiff verlassen, bevor die Briten zwölf Kanonenschüsse auf die Inn abgaben. Und Schultze und seine Frau sahen, wie das Schiff unwiderruflich sank, mit der Sammlung und allem, was sie besaßen.
Nach kurzem Aufenthalt in einem Internierungslager in Dakar – auf Intervention eines französischen Anthropologen ließ man sie frei – landeten sie in Funchal auf Madeira, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachten. Ein besessener Mensch aber gibt nicht auf. Wenn Schultze seine Funde schon nicht vorzeigen konnte, musste er über sie schreiben und sie malen. Denn an das, was einen begeistert hat, erinnert man sich in allen Details. Er setzte sich an die Arbeit, mit der gleichen Besessenheit wie immer. Und starb mitten in seiner Besessenheit, mitten im Schreiben und Malen, nicht älter als dreiundsiebzig Jahre.
Damit könnte die Geschichte zu Ende sein, sagte Anselm. Dann aber gab es den Autor Hannes Zischler und die Illustratorin Hanna Zeckau, die planten, ein Buch über eine Kongo-Expedition zu schreiben. Als sie im Berliner Museum für Naturkunde den Fundus durchgingen, stießen sie auf einen alten verstaubten Koffer – das Objekt 1939-08-12/1 –, von dem niemand etwas wusste. Als sie ihn öffneten, verschlug es ihnen die Sprache.
Der Koffer war bis zum Rand mit Zigarrenkästen gefüllt. Und in den Zigarrenkästen lagen kleine, adrette Päckchen: alles in allem achtzehntausend Regenwaldschmetterlinge, eingeschlagen in Zeitungsausschnitte, Hotelrechnungen, herausgerissene Buchseiten und zerschnittene Briefe. Es war einer von Schultzes Koffern, der, wie sich herausstellte, mit einem anderen Schiff verschickt worden war. Ein Teil der Sammlung war auf wunderbare Weise gerettet worden. Und Arnold Schultze, den man vergessen hatte, gelangte ins Rampenlicht. Denn Zischler und Zeckau ließen das Buch über die Kongo-Expedition sausen. Und schrieben stattdessen über den großen Schmetterlingsforscher.
Ich spürte plötzlich eine Hand, die meine Hüfte streichelte. Lech war aufgewacht. Als ich mich ihm zuwandte, sagte er, ihm sei gerade ein Gedanke gekommen. Wenn man seine Frau nur Tag für Tag und Nacht für Nacht streicheln kann, dann werde jedes Jahr ein Annus mirabilis.
Auf der Insel, 12. Januar 2015
Ich fühle mich guter Dinge. Ein rumänischer Forscherkollege hat mir geholfen, eine Annonce in einer der großen Tageszeitungen seines Landes zu schalten:
»Suche nach meinem Onkel Bruno Seeberger, geboren in Ostpreußen, der nach dem Zweiten Weltkrieg, als er um die dreißig Jahre alt war, nach Bukarest gekommen war. Dem Vernehmen nach hat er als Pilot gearbeitet. Informationen bitte an …«
»Vielleicht lebt ja Bruno noch«, sagte ich zu Lech. »Vielleicht sitzt er im Rollstuhl, fast hundert Jahre alt, und liest die Zeitung mit einer Lupe.«
»Und dann rollt er ans Telefon und ruft dich an«, erwiderte Lech.
Wir lachten. Vor allem, weil das Leben so schön war. Und weil es uns gab.
Auf der Insel, 2. Februar 2015
Es hat die ganze Nacht geschneit. Die Schneehauben wachsen, Büsche und Bäume biegen sich unter der Fülle, der See ist zum großen weißen Flachland geworden. Wie leben die Fische jetzt ihr Leben? Stehen sie unterm Eis reglos in der Dunkelheit? Oder schwimmen sie umher, als gäbe es kein Eis?
Und ich? Ich gleiche einem Faultier, das sich im Baum festgehakt hat. Ich habe mich an Bruno festgehakt. Und kann meinen Griff nicht lockern, nicht einmal jetzt. Obgleich sich die Annonce als verlorene Liebesmüh erwiesen hat. Nicht eine einzige Antwort war gekommen. Lech fragte mich heute, warum es mir so schwerfiel aufzugeben.
Ich fragte ihn, ob er sich an Elisabeth Costello, den Roman von J. M. Coetzee, erinnerte. Am Ende des Buches will die gealterte Autorin die Grenze zur anderen Seite passieren. Um das tun zu können, muss sie jedoch eine Erklärung abgeben. Und sie schreibt, dass sie Sekretärin des Unsichtbaren sei, eine von vielen Sekretären im Laufe der Jahrhunderte. Sie schreibe nur auf, was sie höre, so genau sie es vermöge. Das sei ihr Beruf: Texte nach Diktat zu schreiben.
Und ich höre Bruno, sage ich. Schon als ich noch ein Kind war und daran dachte, wie er tot im Schnee von Stalingrad lag, redete er zu mir. Und als ich erfuhr, dass er nicht tot war, redete er noch mehr. Er ist jedoch zu weit weg, als dass ich seine Worte vernehmen könnte. Das Einzige, was ich höre, ist seine Stimme, eine Stimme, von der ich mich nicht abwenden kann. Ich muss näher an sie heran, obwohl ich nicht weiß, wie.
Lech fragte, warum gerade Brunos Stimme so zwingend war. Vielleicht geht es um ein Wiedererkennen, sagte ich, so wie man sich von gewissen Menschen angezogen fühlt, auch von gewissen Büchern, gewissen Bildern und gewisser Musik. Man erkennt etwas aus der eigenen tiefsten Tiefe wieder, etwas, was den Boden für all das bildet, was man ist.
Lech sagte, er glaube zu verstehen. Dann erzählte er eine Geschichte, an die er sich ausgerechnet jetzt erinnerte, aus einem Grund, den er nicht begriff. Bevor wir uns begegnet waren, hatte er eine Zeit lang in Österlen gewohnt. Dort hatte er einen langen Spaziergang unternommen, als er an einer umzäunten Wiese vorbeigekommen war, auf der es überall Maulwurfshügel gab. Ein Mann mit Sportmütze war gerade beim Reparieren des Zauns. Als Lech mit ihm sprach, erzählte der Mann, dass er neugeborene Maulwurfjunge in der Hand gehalten hatte. Dass sie nackt und blind waren und nicht größer als eine Puffbohne, hatte ihm nichts ausgemacht. Aber, dass sie zitterten. Auch als er sie weggelegt hatte, war das Zittern in seiner Hand verblieben.
Auf der Insel, 11. März 2015
Ich packte Mutters Sachen in einen Karton. Auch ihr Adressbuch. Ich wusste, was auf der Seite neun (bei den Buchstaben I und J) stand, in ihrer kindlichen Handschrift geschrieben, etwas, was ich nicht sehen wollte:
Hingeschüttet bin ich wie Wasser,
gelöst haben sich alle meine Glieder,
mein Herz ist geworden wie Wachs,
in meinen Eingeweiden zerflossen.
Warum blätterte ich die Seiten wieder durch? Nur um mir erneut bewusst zu machen, wie wenig Menschen Mutter verblieben waren? Die meisten Adressen und Telefonnummern betrafen Ärzte, Handwerker und Ämter. Dann gab es da meine Nummer, ich, die in ein anderes Land geflohen war. Und die Nummer ihres Friseurs, der ihr die grauen Haare schnitt, dass sie einem Helm aus Stahl glichen. Und die Nummer von Vaters Verwandten in der Schweiz, die sie seit Vaters Tod nicht mehr getroffen hatte. Und die eines Pflegeheims in Güstrow, wo der Einzige von Mutters Geschwistern, der noch am Leben war, sich an nichts erinnerte. Und die von Alois, der das erfahren durfte, was Mutter mir nie erzählt hatte. Und die von Hannes Grünhoff in Berlin, ein Name, den ich noch nie gehört hatte.
Auf der Suche nach Bruno
Wannsee, im April 2015
Dass ein Garten so üppig blühen konnte – überall Tulpen und Osterglocken und ein großer alter Kirschbaum, dessen Äste vor lauter Blüten kaum zu sehen waren. Und dann die Wärme! Mit einem Mal gingen die Berliner Frauen in dünnen flatternden Kleidern umher, mit nackten Armen und Beinen.
Ich stand am Gartentor mit dem eisernen Türgriff in der Hand, der von der Sonne erwärmt war. Der Schotterweg, der zum Haus führte, war frisch geharkt, ein weiß gekalktes Haus, die Wände mit wildem Wein bewachsen. Einen Moment lang hielt ich inne. Es war, als würde der Kirschbaum klingen, als säße dort jemand und ließe den Bogen über ein Cello gleiten, nur ganz leicht über eine der Saiten. Wie wenn es auf unserer Insel die Bienen zu den Kirschbäumen zieht und Lech sagt: Jetzt singen unsere Bäume.
Ich öffnete das Tor und ging zum Haus hinauf. Die Tür war blau gestrichen, als hätte sie die Farbe vom Himmel entliehen. Ich drückte auf die Klingel. Es ertönte ein Dreiklang, ein Klang in Dur hätte Vater gesagt, der das absolute Gehör besaß. Eine kleine, rundliche Frau öffnete, gekleidet in ein taubengraues Leinenkleid. Auch ihr Haar war grau, langes, geflochtenes graues Haar, das sie als Kranz um den Kopf gelegt hatte. Ihr Gesicht wirkte glatt. Erst als das Licht darauf fiel, wurde ein Netz feiner Falten sichtbar. Sie lächelte, als ich meinen Namen sagte, und wir gaben uns die Hand. Ihre Hand war warm, hatte einen festen, freundlichen Griff. Und sie sagte ihren Namen mit klingender Stimme: Sabine Grünhoff.
Sie würde Hannes holen, sagte sie. Er befände sich in der Werkstatt, obwohl Sonntag war. Er konnte nicht anders. Ob ich einen Moment auf der Terrasse Platz nehmen wollte? Ich fragte, ob ich sie nicht begleiten könnte. Werkstätten fand ich immer verlockend. Und so gingen wir zusammen hin.
Es war eine große, helle Werkstatt, nach Malerfarbe und Holz duftend. An der Arbeitsbank stand Hannes D. M. Grünhoff, der einst Dmitri H. Michailowitsch Fjodorow hieß: ein großer, breiter Mann im langen weißen Kittel wie ein Doktor. Seine Unterschenkel waren nackt und bleich, um die Knöchel ein Netz blau schimmernder Venen. Die Füße steckten in schwarzen Holzpantoffeln. Das Gesicht war rund und rosig, das Haar weiß gelockt. Doch was den Blick an ihm am meisten anzog, waren seine braunen Augen: Sie strahlten hinter der Brille wie die eines glücklich Verliebten.
Er war dabei, die Teile für einen Stuhl zu schleifen. Denn Stühle seien seine Spezialität, sagte er, selbst wenn er auch Tische und Schränke gemacht habe. Doch Stühle zu bauen wäre das Schönste überhaupt. Und zugleich das Schwierigste: einen Stuhl anzufertigen, der den Menschen trägt, sodass er seinen Körper vergisst und sich dem widmen kann, was ihn vom Tier unterscheidet, dem Denken. Fantasie – wenn sie frei sein soll – erfordert einen guten Stuhl. Und es ist in der Tat eine Kunst, einen solchen zu bauen. Es hatte ihn viele Jahre gekostet, das zu erlernen. Und jetzt konnte er es einfach nicht lassen, obwohl er schon dreiundachtzig und seit Langem in Rente war.
Er zeigte mir die Werkstatt, die unterschiedlichen Holzsorten, die Leinölfarben und Werkzeuge. Das Holz sei das Wichtigste, sagte er, Holz zu finden, das sich formen lässt und das nicht müde wird, die Schwere des Menschen zu tragen, auch nicht nach Jahrhunderten. Bei Stradivaris Geigen hatte er gelesen, dass sie aus Ahornholz gebaut waren, mit einer Dichte, die alles übertraf. Und dass es dieses Ahornholz in den Bergen des Balkans gab. Die dortigen Winter mit ihren eisigen Stürmen und die Sommer mit ihrer brennenden Hitze bewirkten, dass die Bäume nur langsam wuchsen, mit ungewöhnlich starkem Holz. Holz, das auch für seine Stühle passen könnte. Denn war es nicht schließlich so, dass Geigen und Stühle zusammengehörten? Beide befreiten den Menschen von seiner Schwere.
Wir nahmen auf der Terrasse auf Ahornstühlen Platz, gestrichen mit hellgrüner Leinölfarbe, es war genau die Farbe, sagte Grünhoff, die das Ahornlaub der Karpaten im Frühjahr zeigte. Er saß mir gegenüber, in weißem Leinenhemd und beigefarbenen Shorts, zwischen uns ein Tisch, gestrichen in derselben hellgrünen Farbe. Neben ihm saß seine Frau. Sie wollte seine Geschichte gern hören, sagte sie, obgleich sie sie schon früher vernommen hatte. Wie zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter vor einer Reihe von Jahren zu ihnen gekommen war.
Mutter hatte erwähnt, dass sie Witwe war. Vater war im Dezember 2002 gestorben, Mutter im November 2007. Also musste sie irgendwann in diesen fünf Jahren hier gewesen sein. Es regnete, als sie kam, sagte Grünhoff, ein gewaltiger Regen, als wollte eine Sintflut Berlin ertränken. Als Mutter vor seiner Tür stand, dachte er, sie sähe aus wie jemand, der in Noahs Arche keinen Platz bekommen hatte. Also sah er sich gezwungen, ihr Tee mit Rum anzubieten. Und seinen schönsten Sitzplatz, einen Stuhl aus transsylvanischem Ahorn.
Ich fragte, ob Mutter mich erwähnt hatte. Grünhoff sah das vor ihm stehende Glas an, eins der drei Gläser, die seine Frau auf den Tisch gestellt hatte, gefüllt mit Berliner Weiße, einem hellen kalten Bier, gewürzt mit Waldmeister, der es grün schimmern ließ. Nein, sagte er nach einer Weile, sie sprach nur von Bruno. Er erinnerte sich genau, dass sie gesagt hatte, er wäre der letzte Mensch, den sie, falls er also am Leben war, noch hatte.
»Wir sollten das Bier jetzt trinken«, sagte Grünhoffs Frau. Und Grünhoff hob sein Glas und rief: »Prost!« Ich nahm einen Schluck. Es schmeckte gut. Ich dachte an Mutter, die als Kind in Ostpreußens Wäldern Waldmeister gepflückt hatte, große Büschel blühenden Waldmeisters, aus denen Großmutter Sirup kochte. Sirup, der der Bowle Duft und Geschmack verlieh, die auf den samstäglichen Abendgesellschaften in Mutters Elternhaus serviert wurde, einem großen weißen alten Gutshaus ein Stück vor Pieniȩżno, das damals Mehlsack hieß. Die Bowle kam auf den Tisch, wenn der Tanz begann, eine grün schimmernde Bowle, mit der sich Großvater erfrischte, nachdem er die schönsten Frauen Mehlsacks in seinen Armen herumgewirbelt hatte, so lange, bis sie seine Ansicht teilten: dass die Menschen füreinander geschaffen waren, ganz besonders sie und er.
Ich zog das Bild von Chopin aus meiner Tasche. Grünhoff sagte, er ähnele Bruno, nur sei Bruno magerer gewesen.
Hatte Grünhoff vielleicht Bilder von Bruno?
»Kein einziges«, sagte er, »auch keins von Dinu.«
»Wer war Dinu?«
»Das ist eine lange Geschichte«, erwiderte Grünhoff.
Ich sagte: »Ich habe alle Zeit der Welt.«
»Die hatte Ihre Mutter nicht«, sagte Grünhoff. »Sie wollte nur von Bruno reden hören.«
Ich sagte, ich wolle alles hören.
Er fragte: »Die ganze Geschichte meines Lebens?«
Ich antwortete: »Ja.«
Dmitri Fjodorows
alias Hannes Grünhoffs Geschichte
Teil 1
Alles begann 1928 mit dem Sechsten Weltkongress der Kommunistischen Internationale, der, wie Grünhoff sagte, die reinste Katastrophe war. Denn dort kam man zu dem Entschluss, die Sozialdemokraten als Handlanger des Kapitals zu betrachten, die somit als Feinde bekämpft werden mussten. Hätte man mit ihnen zusammengearbeitet, hätte man Hitler vielleicht stoppen können. Nun aber schaufelte man sich sein eigenes Grab, die deutschen Kommunisten jedenfalls. Und auch Grünhoffs Mutter.
Das aber hatte sie damals nicht verstanden. Während der Weltkongress stattfand, war er das Wunderbarste, was in ihrem Leben je geschehen war. Denn auf ihm gab es einen russischen Delegierten: einen jungen Lehrer, der, obwohl er Kommunist war, einem Prinzen aus Tausendundeiner Nacht glich. Er brannte für die Befreiung des Volkes vom kapitalistischen Joch und bald auch für Grünhoffs Mutter, die als junge Journalistin über den Kongress berichtete. Auch seine Mutter begann zu brennen. Es endete damit, dass sie als freie Korrespondentin zu ihrem Liebsten nach Moskau zog.
Es spielte keine Rolle, dass sie arm waren und beengt wohnten. Und dass ihr Paradies oft nach Schtschi, der russischen Kohlsuppe, roch. Sie waren glücklich und überzeugt, an der Schaffung einer besseren Welt mitzuwirken. Später sollte seine Mutter sagen: Das einzige Schöne, was sie zu schaffen vermocht hatten, sei er, Dmitri Hannes Michaijlowitsch Fjodorow, gewesen, ihr einziges Kind, das 1932, am ersten Tag des letzten glücklichen Jahres, geboren wurde.
Im Jahr danach änderte sich alles. Hitler wurde Reichskanzler. Und schon bald bestand keine Möglichkeit mehr, als links eingestellte deutsche Korrespondentin tätig zu sein. Die deutschen Zeitungen wurden gleichgeschaltet und nazifremde Komponenten – wie die Artikel der Mutter – eliminiert. Und auch in Moskau geschahen Dinge. Man sagte nicht mehr alles, was man dachte. Die es dennoch taten, wurden von der Geheimpolizei abgeholt und nie wiedergesehen. Manchmal wurde man auch abgeholt, obwohl man nichts Unerlaubtes gesagt hatte. Alle wussten, dass es zwei Bezeichnungen gab für jemanden, der flüsterte: Scheptschuschi für den, der flüstert, um nicht gehört zu werden, und Scheptun für den, der hinter deinem Rücken den Behörden ins Ohr flüstert. Und ein neuer Geruch breitete sich aus, Angstgeruch, nach dem Geruch des Todes der schlimmste von allen.
Genauso hatte seine Kindheit gerochen, sagte Grünhoff: nach Angst und Kohlsuppe. Und nach Seife und Bohnerwachs. Manchmal gingen er und seine Mutter an die Moskwa, um all den Gerüchen zu entkommen. Sie saßen am Wasser, und die Mutter erzählte von den Flüssen und Seen in Berlin: der Spree und der Havel und vom Wannsee, wo sie in einem großen weißen Haus aufgewachsen war. Wenn sie erzählte, konnte man auf die Idee kommen, dass sie sich nach einer anderen Zeit sehnte, einer Zeit, die es nicht mehr gab, nicht einmal in Berlin. Eine Zeit mit dem Duft nach Freiheit. Er meinte ihn zuweilen zu spüren. Wenn eins der kleinen Holzschiffe, die er gebaut hatte, auf der Moskwa davonfuhr. Es spielte keine Rolle, dass der Vater ihm den Weg des Holzschiffs im Atlas zeigte: dass es über die Oka und Wolga im Kaspischen Meer landete, was nicht wirklich ein Meer war, sondern ein von Land umschlossener See.
Wenn die Mutter und er allein waren, sprachen sie Deutsch. Und sie nannte ihn ihren Hannes, so wie ihr Großvater geheißen hatte. Waren der Vater und andere Menschen dabei, sprachen sie Russisch. Er hatte eine Mutter- und eine Vatersprache. Eine Sprache, in der er sich fortträumen konnte, und eine für die Wirklichkeit.
Doch er musste seiner Mutter versprechen, nie mit jemand anderem Deutsch zu sprechen. Er durfte auch nicht erzählen, dass seine Mutter aus Deutschland kam. Sie war eine passionierte Sowjetbürgerin, und damit basta. Es war ein Glück, dass sie einen Vornamen – Anna – hatte, der auch in der Sowjetunion gebräuchlich war. Und dass sie akzentfrei Russisch sprach. Obendrein stand sie mit ihrer Familie in Berlin nicht mehr im Briefwechsel. Vielleicht hatte sie gehört, dass das Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten eine »Deutsche Operation« durchführte: Sowjetbürger deutscher Herkunft und deutsche Emigranten galten systematisch als Terroristen und als Spione und wurden verhaftet. Doch Mutter nicht. Hatte der Vater Beziehungen? Oder war die Quote der zu Verhaftenden erfüllt?
Sein Vater war oft wie abwesend. Er schaffte es kaum, von der Schule heimzukommen und seine Kohlsuppe zu löffeln, da war es schon wieder an der Zeit, sich der Parteiarbeit zuzuwenden. Es ist die Pflicht des Menschen, sagte er zu seinem Sohn, alles nur Mögliche für sein Land zu tun. Und dann strich er Dmitri mit seiner weichen Hand sanft übers Haar, ein wenig zerstreut, aber dennoch.
Und der Einsatz des Vaters lohnte sich. Im Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg wurde er zum Direktor einer der besten Moskauer Schulen ernannt. Sie bekamen eine Dienstwohnung mit einem großen Stalin-Gemälde im Wohnzimmer. Stalin stand hoch aufgerichtet vor der roten Sowjetfahne mit Hammer und Sichel und blickte schräg nach rechts, mit leicht zusammengekniffenen Augen, als sei er misstrauisch. Man konnte meinen, es sei das Beste, auf der linken Seite zu stehen. Freitags wurde Stalin abgestaubt, wie alles andere in der Wohnung. Manchmal sah es aus, als ob die Mutter mit dem Staubwedel nach ihm schlug, während sie einen alten Schlager trällerte, zu dem sie in Berlin getanzt hatte.
Oder sie summte Jazzsongs, die das Jazzorchester Alexander Warlamows im Zentralen Haus der Roten Armee spielte oder Moskaus erste Frauenjazzband im Zentralen Klub der Holzveredlungsindustrie. Dorthin gingen die Eltern, wenn sie eine Pause vom Klassenkampf brauchten. Oder sie gingen ins Theater, während ein kaukasisches Mädchen auf Dmitri aufpasste. Sie habe am Asowschen Meer gewohnt, erzählte sie mit einem Blick, als sehnte sie sich dorthin, obgleich auch das kein richtiges Meer war, sondern nur ein großer See.
Er war neun Jahre alt, als Hitler am 22. Juni 1941 den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion brach und die deutschen Heereskräfte ins Land eindrangen. Der Vater zögerte keinen Augenblick, um sich als Soldat zu melden und im Großen Vaterländischen Krieg zu kämpfen, wie Stalin das Schlachten nannte. Die Mutter sagte, sie sei stolz auf ihn. Trotzdem aber weinte sie. Wie einmal, als Dmitri in die Küche kam und sie wie eine Besessene die Kartoffeln schrubbte, um ihre Tränen zu verbergen. Vielleicht dachte sie nicht nur an den Vater, sondern auch an ihre Eltern und ihren Bruder in Berlin. Er getraute sich nicht zu fragen, der Angstgeruch war zu stark.
In einer der ersten Kriegswochen bekamen sie einen Brief von der Front. Er erinnerte sich nicht, was der Vater geschrieben hatte, nur an das beigefügte Foto. Darauf stand er hoch aufgerichtet vor seinem Panzer, den Blick geradeaus gerichtet, so als fürchte er nichts. Dennoch glich er vor allem einem Prinzen aus Tausendundeiner Nacht, der sich als Soldat verkleidet hatte. Das Foto kam auf dem Beistelltisch zu stehen, im Goldrahmen, direkt gegenüber dem Stalin-Bild. Manchmal nahm die Mutter das Foto in die Hand und betrachtete es. Da konnte es vorkommen, dass ihre Augen blank wurden, so als bräche sie gleich in Tränen aus. Insbesondere, wenn die Zeitungen von einer erneuten Niederlage der Roten Armee berichteten.
Der Krieg war erst einen Monat alt, als die deutsche Luftwaffe mit ihren Bombenangriffen auf Moskau begann. Die Moskauer rannten zu den Schutzkellern, wenn das Geheul der Warnsignale über der Stadt erklang. Er und die Mutter liefen zur Station Majakowskaja, einer von Moskaus neuen Metro-Stationen, die dreißig Meter unter der Erde lag. Es war, als betrete man eine andere Welt. All die glänzenden Säulen, die schimmernden Marmorböden, die goldenen Lampen! Als käme man in die Säulenhalle eines kaiserlichen Palastes. Die eines gastfreundlichen Kaisers, der seinen Gästen Schlafpritschen mit weichen Decken und weichen Kissen bot. Und Dmitri lag ausgestreckt da und blickte zu den Deckengemälden hoch, während ihm die Mutter Märchen aus einer anderen Zeit erzählte. Märchen auf Russisch, in denen die Guten stets siegten. So wie es auch jetzt geschehen würde.
Auch seine Mutter leistete ihren Beitrag zum Großen Vaterländischen Krieg. Sie half mit beim Bau von Panzergräben und schleppte Sandsäcke, die man vor den Schaufenstern der Läden stapelte. Und sie zeigte ihm, wenn sie durch die Stadt gingen, wie listig die Moskauer waren, genau wie Odysseus, der den Trojanern ein Schnippchen geschlagen hatte, indem er das griechische Heer in einem gigantischen Holzpferd versteckte. Die Moskauer strichen die goldenen Kuppeln der Kirchen graugrün und verbargen Teile der Moskwa unter mächtigen Holzabdeckungen, um die deutsche Luftwaffe zu täuschen. Während Dmitri Holzflugzeuge baute, eine ganze Armada, die Hitlers Wehrmacht vernichten sollten.
Die Deutschen aber rückten mit rasender Geschwindigkeit weiter voran. Bis sie Smolensk erreichten, das nur vierhundert Kilometer von Moskau entfernt lag. Erst nach wochenlangem Kampf gelang es Hitlers Streitkräften, die Stadt zu erobern, ein Kampf, bei dem zahllose Soldaten starben, nicht aber Dmitris Vater. Er überlebte und wurde für seinen Mut sogar mit einer Medaille geehrt. Er zeigte sie Dmitri, als er auf einen kurzen Fronturlaub heimkam. Es war nur merkwürdig, dass er kein bisschen stolz darauf zu sein schien.
Am nächsten Tag aber – dem 7. November 1941, dem Jahrestag der Oktoberrevolution – hatte er die Medaille angelegt, als er mit seinem Panzer in der großen Militärparade mitfuhr, auf deren Durchführung Stalin bestanden hatte, obwohl der Krieg nicht weit vor Moskau tobte. Die Welt sollte sehen, wie ungeheuer stark die Sowjetunion war. Sie sollte verstehen, dass das, was Stalin vom Dach des Lenin-Mausoleums rief, die Wahrheit war: dass die Reserven der Sowjetunion unendlich waren, während die Hitlerdeutschlands bereits dem Ende zu gingen.
Ein eiskalter Wind kam auf. Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Moskau war von Schnee bedeckt, auch die marschierenden Soldaten und die vorbeirollenden Panzer. Dmitri und seine Mutter standen unter den Zuschauern. War das da nicht der Vater, der mit seinem Panzer vorbeifuhr? Sie sahen die Köpfe der Panzerschützen, die aus der offenen Luke ragten. Doch sie konnten sich irren. Die Militärparade, die auf dem Roten Platz vorüberzog, war weit entfernt. Und die Köpfe der Schützen waren so klein. Und Stalin auf dem Dach des Mausoleums nicht größer als ein Punkt. Auch die Katjuscha oder Stalinorgel, wie die Deutschen sie nannten, war kleiner, als Dmitri gedacht hatte. Wie konnte ein Raketenwerfer, der in einer halben Minute mehr als hundert Geschosse abfeuerte, nicht viel anders aussehen als eine einfache Kanone!
Einen Tag später kehrte der Vater an die Front zurück. Bevor er ging, umarmten er und die Mutter sich lange. Dann drückte er Dmitri fest an sich und forderte ihn auf, zu einem rechtschaffenen Mann zu werden. Der Vater sagte nicht mehr »zu einem guten Bolschewiken«.
Der Winter wurde immer erbarmungsloser, die Temperaturen sanken auf minus dreißig Grad. Das Wetter, las man in den Zeitungen, war aufseiten der Roten Armee. Denn die russischen Soldaten auf ihren Skiern flogen über die schneebedeckten Weiten, in warmer schneeweißer Winterkluft, unsichtbar und unüberwindlich. Während Hitlers Soldaten, denen die Winterausrüstung fehlte, im Schnee feststeckten und bibberten. Das war der Preis der Dummheit, sagte einer von Dmitris Klassenkameraden, dessen Vater General war. Wie konnten die Deutschen so sicher sein, dass sie es schaffen würden, Moskau noch vor dem Winter einzunehmen? Jetzt erfroren sie, ihre Nase und ihr Penis würden zu Eiszapfen, die bei der geringsten Bewegung abfielen. Dmitri dachte an seinen deutschen Onkel. Hatte auch er seine Nase und seinen Penis verloren?
Hitlers Wehrmacht aber ließ sich durch die Kälte nicht stoppen, sie rückte immer näher an Moskau heran. Und der Angstgeruch in der Stadt wurde stärker und stärker. Fast beneidete man diejenigen, die einen allmächtigen Gott besaßen, zu dem sie beten konnten. Als Bolschewik hatte man nur Stalin und seine Generäle, an die man glauben konnte. Und das fiel nicht so leicht, als der Befehl erteilt wurde, Moskau zu evakuieren. Nicht einmal Lenin durfte in seinem Mausoleum bleiben, obwohl er seit vielen Jahren tot war.
Начислим
+54
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе