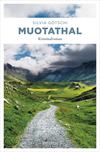Читать книгу: «Mord im Parkhotel», страница 2
»Ich tue meinen Job wie Sie auch«, kam es barsch zurück.
Mir genügte es, noch bevor ich richtig angefangen hatte. »Gibt es noch andere Mitarbeiter, die vor sechs ins Haus kommen?«, fragte ich.
»Nein, niemand sonst. Die anderen fangen erst nach sechs an.« Seine Stimme hatte sich wieder normalisiert.
»Gut, am Montagmorgen um zehn haben Sie Zeit, sich in unserem Büro eingehend mit dem Thema zu beschäftigen.«
»Aber dann muss ich arbeiten.«
Wir blickten uns an, als wären wir Bluthunde, die einander nächstens an die Kehle springen wollten. Ich hatte den Mann vom ersten Augenblick an verachtet, als er mir seine Gleichgültigkeit demonstrierte. Ich wandte mich von ihm ab und ging. Unter der Türe drehte ich mich noch einmal nach ihm um. »Wie heissen Sie eigentlich?«
Er hüstelte: »Dante Ripiosi.«
Ich nahm meinen Notizblock zur Hand, um den Namen zu notieren, weil ich ihn wohl kaum behalten konnte.
»Ich bin gebürtiger Sizilianer«, rief er mir nach. Beim ersten Moment klang es so, als wollte er mich mit seiner Herkunft warnen. Ich verwarf den Gedanken. Er hatte mir schlichtweg eine Erklärung seines kuriosen Namens geben wollen. Vielleicht würde ich ihn doch nicht vergessen.
Zurück in meinem Wagen, stellte ich die Nummer von Salomés Mobiltelefon ein, bekam aber ausser der Dienststimme des Betreibers nichts zu hören. Ich wusste nicht, ob ich beruhigt aufatmen oder mir Gedanken machen sollte. Ich verspürte plötzlich ein starkes Bedürfnis, Salomé in die Arme zu nehmen.
***
Später fuhr ich zur Kasimir-Pfyfferstrasse, zur Einsatzzentrale. Der Verkehr hatte zugenommen. Die Stadt war so abrupt erwacht wie jeden Tag. Nicht einmal während der Wochenenden schien Ruhe einzukehren. Die Autokolonnen wälzten sich doppelspurig zwischen den Häusern durch. Fahrradfahrer schlängelten sich todesmutig um die Wagen herum, schlossen die Lücken, die von den Linienbussen entstanden, wenn sie an den Haltestellen stoppten. Der Tag versprach, wieder heiss zu werden, wie alle die Sommertage zuvor. Ich dachte an die Badenden im Lido oder beim Alpenquai, an schattige Plätze unter Linden, an ein kühles Bier. Aber ich musste mich wohl auf viel Arbeit einstellen.
Wer war die Frau, die mich an Salomé erinnerte? War sie verheiratet? Hatte sie Familie? Im Büro würde ich ihre Adresse ausfindig machen können. Ausser meiner Mitarbeiterin Nina Buholzer war noch niemand anwesend. Und meinen Kollegen Julien Roduit hatte ich an diesem Morgen noch nicht erreicht. Ich erinnerte mich, dass er dieses Wochenende keinen Bereitschaftsdienst hatte.
Nina schaute mich mit ihren kugelrunden, dunklen Augen an, als ich in ihr Büro trat, wo sie vor dem Computerbildschirm sass. Sie galt als das Argusauge der Abteilung schlechthin. Sie war bald sechzig, sah aber jünger aus, was sicher an ihrem sportlichen Kurzhaarschnitt und dem dezent geschminkten Gesicht lag. Ich war mir nie sicher, wie diese Frau es schaffte, in allen Lagen, und waren sie noch so verzwickt, mit ihrer ansteckend guten Laune präsent zu sein. Ich lächelte ihr zu. Ein schwacher Versuch, ihrer sympathischen Art näherzukommen. »Könntest du mir ein paar Dinge abklären?«
Sie nickte kurz und strich sich mit der Hand durch ihre flippige Frisur. »Klar doch. Geht es um die Tote im Sempacherpark?«
»Du weisst davon?«
Mein Erstaunen quittierte sie mit einem heftigen Kopfnicken. »Der Chef hat mich schon darüber informiert. Leider haben wir sie noch nicht identifizieren können.«
Verdammt, die Handtasche. Ich musste mich setzen.
»Ist dir nicht gut?« Nina sah mich besorgt an.
»Ich komme gleich wieder«, sagte ich und stand auf.
Auf dem Korridor rief ich auf Daniels Mobiltelefon an. Er meldete sich mit Verzögerung.
»Bist du allein?«
»Ja, wo brennt’s? Wir haben gerade die Tote zum Transport bereit gemacht.«
»Erinnerst du dich an die Handtasche auf der Parkbank?« Meine Hände fühlten sich feucht an, der ganze Rücken, die Brust.
»Was für eine Handtasche?«
Ich war überrascht. Das konnte doch nicht sein, dass Daniel sie übersehen hatte. Ich befürchtete, dass er die Nacht nicht ganz im Trockenen verbracht hatte. Vielleicht mein Glück. »Hat Werner sie erwähnt?«
»Was erzählst du da?« Daniel war hörbar erstaunt.
»Hör’ zu«, sagte ich. »Ich habe da ein kleines Problem. Die Handtasche ist in meinem Wagen. Ich weiss nicht, was ich mir dabei gedacht habe, als ich sie von der Bank weggenommen habe.«
«Bist du bescheuert?» Daniel geriet ausser sich. »Hast du wenigstens Handschuhe getragen?«
»Nein, woher sollte ich die denn haben?«
Ich hörte lange nichts mehr. Jetzt dachte er über meine Dummheit nach und wie er mich aus dieser miserablen Lage wieder befreien konnte. »Gut«, sagte er nach einer Weile. »Du kannst die Tasche in mein Büro bringen. Lege sie in die oberste Schreibtischschublade.« Er unterbrach die Verbindung.
Ich kehrte zu Nina zurück. »Ihr Name ist Catherine Mahler«, sagte ich, um den Eindruck zu hinterlassen, dass ich deswegen vor der Tür gewesen war. »Bitte überprüfe, wo sie wohnt und ob sie Familie hat.«
Ich ging wieder auf den Korridor und ärgerte mich erneut, dass ich keine Zigaretten dabeihatte. Ich liess einen lauwarmen Kaffee aus dem Automaten und trank ihn in einem Zug aus. Mein Körper reagierte mit einem Schweissausbruch. Mir wurde schwindlig. Nur ganz unterschwellig verspürte ich eine Unsicherheit, die so schnell vorüber war, wie sie sich bemerkbar gemacht hatte.
***
Der erste Lagebericht fand in Hellers Büro statt. Toni Heller war der Untersuchungsrichter und zuständig für die Stadt. Ein rundlicher Mann mit grauen Geheimratsecken. Korner war jetzt da. Seine charismatische Erscheinung übertraf alle, selbst den korpulenten Heller. Er hatte sich die Haare geschnitten, was mir als Erstes auffiel. Etwas zwischen Bürstenschnitt und Radikalrasur, wohl der Hitze wegen. Er war dann auch der einzige Anwesende, der nicht schwitzte. Den anderen stand die harte Arbeit des Morgens ins Gesicht geschrieben. Daniel erschien etwas später. Er zwinkerte mir zu, was für mich wieder alles ins Lot brachte. Ich atmete auf.
»Meine Damen, meine Herren«, sagte Heller, was mir in Erinnerung rief, dass wir auch ein paar weibliche Mitarbeiter in unserer Abteilung hatten. Es würde uns guttun, hatte Korner gesagt, als irgendwann einmal zur Diskussion stand, ob die Frauen der Arbeit in der Kripo überhaupt gewachsen wären, ob sie dem Druck psychisch standhalten würden. Immerhin hatten wir im letzten Halbjahr gleich vier neue Mitarbeiterinnen bekommen. Vier Frauen, die die Polizeischule mit Bravour gemeistert hatten. Vier Polizistinnen, die jene Auflockerung in unsere Büros brachten, die Korner prophezeit hatte. Seit die Damen hier arbeiteten, waren die Herren in ihrer Ausdrucksweise um einiges gesitteter geworden. Wenn man es aus dieser Sicht betrachtete, so hatte die Gleichberechtigung doch etwas gebracht.
»Wir haben eine weibliche Leiche auf einer Bank im Sempacherpark«, sagte Heller. »Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir lediglich, dass die Frau nicht am Fundort umgebracht worden ist. Es sind Reifenrückstände gefunden worden, die nicht aus dem Park stammen. Sie werden im Labor untersucht.« Heller räusperte sich hinter vorgehaltener Hand. »Fest steht, dass die Frau durch Strangulieren oder durch einen Genickbruch ums Leben gekommen ist.«
Das war neu für mich. Davon hatte Daniel nichts erwähnt. Ich schaute ihn zwischen den glänzenden Köpfen der Anwesenden hindurch an. Aber er bemerkte mich nicht.
»Die genaue Todesursache wird in der Rechtsmedizin abgeklärt«, sagte Heller.
»Gibt es Zeugen?« Die Stimme kam aus der linken Ecke. Sie gehörte Marcel Jenny, dem Kommunikationschef. Soweit ich im Bilde war, hatte er Germanistik studiert, war dann während rund fünf Jahren Sekundarlehrer in einer ländlichen Gegend gewesen und hatte dann zur Kapo gewechselt. Ein intellektueller Medienmann, ein schlanker stattlicher Typ um die vierzig, genau die richtige Person für Korner und nicht für ein Dorf am Ende der Welt.
»Leider konnten erst zwei Zeugen ermittelt werden«, fuhr Heller fort. »Ein Dauergast aus dem Sempacherpark und der Empfangschef von The Hotel gleich nebenan. Es wird sich herausstellen, wie nützlich diese sind.« Er machte eine Pause. »Es ist nicht viel, meine Damen und Herren, und ich hoffe auf Ihren gewohnten Einsatz.«
Daniel hielt auf einmal die schwarze Lacktasche in den Händen und kippte deren Inhalt vor Korner auf den Tisch. »Vielleicht sollte man die Zylinder zu den Schlüsseln hier ausfindig machen«, sagte er.
»Die Schlüssel zur Wohnung der Toten«, stellte Korner fest.
»Es sind zwei verschiedene Schlüssel«, berichtigte Daniel, »jeder anders nummeriert.«
»Wir werden die Schlüssel überprüfen«, sagte Korner und steckte sie in einen Plastikbeutel. Insgeheim hoffte ich, dass er den Beutel nicht verlegte.
»Andy!« Conradins Stimme neben mir riss mich aus meinen Gedanken. »Du wirst zusammen mit Julien an die Sache herangehen und vorerst das nähere Umfeld der Toten ausfindig machen.«
Ich wusste, was das hiess: Zeugenbefragungen im Umfeld der Ermordeten. Akribisch genaue Analysen der Personen und deren familiärer Strukturen. Und da ich an diesem Samstag nicht mit Julien rechnen konnte, musste ich mich auf einen Alleingang vorbereiten. Auf den weiteren Verlauf des Rapportes konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich hörte zwar Hellers Stimme, Korners Einwände und Befehle, aber an deren Wortlaut erinnerte ich mich im Nachhinein nicht mehr. Meine Gedanken waren wie aufgelöst. Meine Sinne durcheinander. Wo steckte Salomé?
Erst später informierte Conradin die Leute meiner Abteilung über ihre Arbeit und wies uns entsprechend zu. Viel gab es nicht zu sagen. Und die Möglichkeit, dass sich dies kurzfristig ändern sollte, war gering. Ich fühlte mich leer und stand nicht einmal an einem Anfang. Ich machte mich auf den Weg zur Hertensteinstrasse und parkierte dort meinen Wagen im Autosilo.
Die Altstadt war sehr belebt. Menschen hasteten, spazierten, verweilten. Ihnen schien die Hitze nichts auszumachen. Sie waren unterwegs und freuten sich offensichtlich über das tolle Wetter. Lachende Münder. Krause Nasen. Schlitzaugen. Ein Strom aus bunten Stoffen, weil Sommer war. Eine Gruppe Schüler kam mir entgegen, Fähnchen schwenkend und die Schweizer Nationalhymne singend, alle mit einem roten Shirt bekleidet, auf dem ein grosses Schweizerkreuz prangte. Eidgenössisch nationalsozialistisch. Ich musste über diesen aufgesetzten Patriotismus schmunzeln, wo wir doch in einer Zeit lebten, in der Globalisierung und Fusionierung über die Landesgrenzen hinaus in aller Munde waren. War das die neue Rebellion gegen zu viel Glasnost im eigenen Land? Eine Opposition gegen den Liberalismus? Wie hatten sich die letzten zehn Jahre verändert!
***
Die Adresse hatte ich schnell gefunden. Mit dem Aufzug fuhr ich in den fünften Stock. Mahler stand auf dem kleinen Türschild rechts des Einganges. Ich drückte die Glocke. Sie klang schrill, aber es passierte nichts. Ich klingelte noch einmal. Nach einer Weile wurde die Tür zögerlich geöffnet. Ein blonder, ungekämmter Wuschelkopf kam zum Vorschein, dann nahm ich den ganzen Körper wahr. Ein langes, schlaksiges Mädchen in zerschlissenen Jeans und einem bauchfreien Top, das ein blaues Bauchnabelpearcing zum Vorschein brachte.
»Sie wünschen?« Eine zarte Mädchenstimme.
Ich nannte meinen Namen und musste mich im Nachhinein räuspern. Sie war sehr jung, hatte aber trotzdem etwas Anrüchiges an sich. Ich versuchte ein krampfhaftes Lächeln, was mir in der jetzigen Situation doch nicht gerade passend erschien. Ich musste schliesslich eine sehr traurige Nachricht überbringen. »Ich komme wegen Catherine Mahler«, sagte ich mit trockenem Mund.
»Meine Mutter ist nicht hier«, kam es spontan zurück.
Ich wich einen Schritt rückwärts und blickte die junge Frau an. Mit einer Tochter hatte ich nicht gerechnet. »Kann ich Ihren Vater sprechen?«, fragte ich, in der Annahme, dass es einen Vater gab.
»Der ist auch weg.«
»Darf ich einen Moment reinkommen?« Ich erklärte, wer ich war, und zeigte ihr meinen Dienstausweis. Sie warf kaum einen Blick darauf und öffnete stattdessen die Türe ganz.
»Kommen Sie herein.«
Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, schritt sie voraus in die Küche. Sie hatte lange, schmale Beine. Dieser wippende Gang kam mir bekannt vor. Ich sah, wie sie vom Küchentisch eine Zigarette aus einem angebrochenen Päckchen angelte. »Wollen Sie auch?«
»Ich bin im Dienst«, erwiderte ich und merkte gleichzeitig, wie banal das klang. Ich lechzte geradezu nach Tabak.
Sie machte grosse Augen, schöne Augen, was mir nicht missfiel. »Gilt das auch für Nikotin?« Sie war nicht auf den Mund gefallen. »Was wollen Sie von meiner Mutter?« Sie zündete die Zigarette an, machte einen tiefen Zug und blies den Rauch gleich wieder heftig aus. Sie lehnte jetzt lässig an der Kombination. Sie tat übertrieben selbstbewusst. »Ich heisse übrigens Sophia Glorianda, aber Sie können mich ruhig Sophie nennen.« Ich hatte das Gefühl, sie versuchte, eine innere Unsicherheit geschickt zu kaschieren. »Habe ich mein Fahrrad falsch parkiert oder haben Sie mich beim Kiffen erwischt?«
Da war es schon. Sie lachte. Ihre eingezäunten Zähne entgingen mir dabei nicht. Die heutigen Zahnärzte proklamierten ein perfektes Gebiss. Der Oberkiefer musste etwas über den Unterkiefer hinausstehen, damit die Speisen richtig zermahlt werden konnten. Ich fragte mich nur, was die heutigen Kinder zu zermalmen hatten, wo ihnen doch diese aufgummierten Schnellimbiss-Brote kein Kauen mehr abverlangten und die Jugend nicht mehr gewillt war, auf die Zähne zu beissen. »Ich bin nicht deswegen hier.« Ich würde sie Sophie nennen und meinen ersten Eindruck korrigieren.
»Ach, etwa wegen der Vormundschaftsbehörde? Hören Sie mal, ich bin seit einem Monat volljährig. Ich brauche keine Anstandsbeihilfe.« Sie stiess sich von der Kombination weg und kam einen Schritt auf mich zu. »Hat sie etwas Dummes angestellt?«
»Wer?«
»Meine Mutter.« Abrupter Themenwechsel, als wollte sie mich irreführen. Sie blies mir den Zigarettenqualm ins Gesicht. »Ich sage Ihnen, mein Vater ist ein armes Schwein. Er arbeitet wie der grösste Trottel, und meine Mutter führt ein Leben in Saus und Braus. Immer die neuesten Klamotten, die besten Kosmetika, Fitnessclubs und all den Scheiss, der die Hausfrauen glauben lässt, dass nur dieses Zeugs sie attraktiv hält. Aber wenn man erst mal dreissig ist, so ist der ganze Kram doch gelaufen. Da schaut dir keiner mehr nach.« Die Sätze sprudelten aus ihr heraus, als hätten sie vom eigentlichen Thema ablenken müssen, was mich wiederum misstrauisch werden liess. Ein Charakterzug, der zu meinem Job gehörte, eine Folge auch von einem abgebrochenen Psychologiestudium. Täter sind wie Kinder, welche die Flucht nach vorn in Augenschein nehmen. Hatte sie ihre Mutter umgebracht?
»Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Mutter heute früh tot aufgefunden worden ist«, sagte ich monoton.
Ein gefährliches Schweigen herrschte zwischen uns. Ganz gedämpft vernahm ich das Stimmengewirr auf der Strasse unterhalb der Wohnung, Kindergeschrei, das Bellen eines Hundes. Die ganze Farbe aus Sophies Gesicht war verschwunden. Sie zwang sich zu einem krampfhaften Lächeln. »Das ist wohl ein Irrtum«, brachte sie zögernd heraus. »Meine Mutter ist gestern Abend ins Konzert gegangen. Sie wollte in einem Hotel übernachten, um mich spätnachts nicht zu stören.« Sophie rang um Haltung. »Machen Sie das immer so?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Setzen Sie sich erst einmal hin«, schlug ich vor. »Haben Sie ein Auto?«
Sophie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Wie kommen Sie darauf?«
»Können Sie Auto fahren?«
»Wie man’s nimmt«, sagte sie. »Ich übe noch.«
Sollte ich ihr glauben? Sie verschwand in einem Zimmer. Ich schaute mich um. Die Wohnung war grosszügig ausgestattet, modern eingerichtet und sauber. Durch das Küchenfenster erkannte ich einen Teil der Museggmauer, einen Turm und Wäsche auf einer Dachterrasse. Ich dachte an meine Zweizimmerwohnung beim Bahnhof und nahm dies hier neidvoll zur Kenntnis.
Nach einer Weile kam Sophie mit einem Bilderrahmen in der Hand zurück. »Das ist meine Mutter«, sagte sie und reichte mir ein gerahmtes Porträt.
»Kann ich das Bild mitnehmen?« Sophie nickte. Ich schaute es an. Genau wie Salomé. Ich merkte, wie meine Beine wegzusacken drohten. Gleichzeitig wunderte ich mich über Sophie, die keine Anstalten machte, Näheres über den Umstand des Todes zu erfahren. Vielleicht stand sie unter Schock und verdrängte die Tatsache ganz einfach.
»Hat sie noch eine Schwester?« Ein trostloser Versuch, meine innere Spannung zu beruhigen.
»Nein, sie ist Einzelkind«, sagte Sophie. Es fiel ihr sichtlich schwer zu sprechen.
»Wann kommt Ihr Vater zurück?«
»Der ist auf einer Geschäftsreise und vor Montagabend nicht da.«
»Kann ich ihn erreichen?«
»Kaum, er ist im Ausland. Ich weiss nicht einmal, wo.«
»Hat er Ihnen keine Adresse hinterlassen?«
»Wozu? Wir sind erwachsene Leute in diesem Haushalt. Wir können tun und lassen, was wir wollen, ohne dem anderen Rechenschaft abzulegen.«
Ich räusperte mich. »Was hat Ihre Mutter beruflich gemacht?«
Es dünkte mich, als lachte Sophie gequält auf. »Sie hat ihr Leben auf Kosten meines Vaters voll ausgeschöpft. Sie ist immer unterwegs gewesen, hat sich mit Freunden getroffen und sich die Nächte in Bars um die Ohren geschlagen ...«
Meine Frage war damit nicht beantwortet. Sophie zündete eine neue Zigarette an, nachdem sie die heruntergebrannte im Ascher ausgedrückt hatte.
»Ging das immer so?«
»Ja, schon eine Ewigkeit.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Wie alt war ihre Mutter?«
»39.«
»Und wie war die Ehe?«
»Wie soll die schon gewesen sein?« Sophie zog ihre Schultern hoch. »Meine Eltern haben sich auseinandergelebt. Das ist doch wohl normal, oder?«
»Kann ich einmal ihr Zimmer sehen?«
»Mein Zimmer oder das meiner Mutter?« Sophie drehte sich um.
»Das von Ihrer Mutter selbstverständlich.«
Das Zimmer lag gleich neben der Küche mit einem Fenster auf den Hinterhof. Ein französisches Bett stand darin, frisch bezogen und unbenutzt. Und an der Wand ein modernes Pult mit Computer und Bildschirm. Nicht etwas, was mir bekannt vorkam. »Darf ich mal?« Ich schritt auf die Einbauschränke rechts der Türe zu. Ich öffnete den ersten Türflügel. Fünf Gestellbretter, die spärlich mit Pullover, Shirts und Unterwäsche belegt waren. Im nächsten Stauraum hingen Kleider in meist dunklen Farben, im letzten Hosen, Jacken und ein Mantel – alles sorgsam sortiert und aufgehängt. Kein mir bekanntes Teil. Nicht der feinste Geruch, an den ich mich erinnern konnte. In einer Schuhschachtel auf dem Schrankboden allerlei Papierkram. Vielleicht wurde ich da fündig. »Die nehme ich mit«, sagte ich und klemmte sie mir unter den Arm. »Hat Ihre Mutter irgendwelche Kontakte gepflegt?«
»Natürlich hat sie das. Aber nicht solche, wie Sie denken.«
»Ich meine, hat sie einen Freund gehabt?« Vielleicht hätte ich mich mit dieser Frage selbst mit Problemen belastet. Was, wenn Sophie die Frage mit Ja beantwortete? Wollte ich es überhaupt wissen? Sophie schaute mich verblüfft an. Sie öffnete den Mund, um mir etwas zu sagen, wie es schien, hielt dann aber abrupt inne. Ich stellte fest, dass sie mich auf gar keinen Fall schon einmal gesehen hatte.
»Sie ist eine attraktive Frau gewesen«, sagte ich, auf das Foto zeigend.
»Sie hat gemeint, sie sei attraktiv«, entgegnete Sophie altklug. Es kam mir vor, als hätte sie soeben die Rolle mit der ihrer Mutter vertauscht. »Aber sie hat in Visionen gelebt. Sie hat sich mit Oberflächlichkeiten abgegeben. Irgendwie war sie nicht die Mutter, die man sich unter einer Mutter vorstellt. Eher wie eine Kollegin. Ich glaube, sie hatte irgendwelche Probleme mit sich selber. Nur hat mich das nie interessiert.« Sophie zog die Schultern hoch, als begriffe sie das, was sie sagte, selber nicht. Vielleicht hatte sie ein typisches Konkurrenzdenken. So etwas sollte es scheinbar zwischen Mutter und Tochter geben. »Aber ich kann Ihnen beim besten Willen keine bessere Auskunft erteilen.«
Wieder diese Zweifel. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass Sophie mehr über ihre Mutter wusste, als sie zugab.
»Hat Ihre Mutter den Computer oft benutzt?«
»Manchmal hat sie bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, hat sie zumindest gesagt. Was genau das gewesen ist, weiss ich nicht. Vielleicht hat sie Spiele gemacht oder E-Mails verschickt. Aber ich weiss es wirklich nicht.« Sie wippte jetzt ungeduldig auf den Zehenspitzen.
»Kann ich den mal in Betrieb setzen?«
»Meinetwegen, wenn Ihnen das weiterhilft.«
Ich startete den Rechner auf. Aber beim Passwort kam ich nicht mehr weiter.
»Kennen Sie den Code?«
»Schreiben Sie doch einfach Sophie oder Hans, so heisst mein Vater. Aber sie wird wohl ein pfiffigeres Schlüsselwort verwendet haben, Loveparade oder so.«
Ich hörte einen zynischen Unterton aus ihrer Stimme.
»Sie haben ihre Mutter nicht besonders gern gehabt«, stellte ich fest.
»Merkt man das?«, Sophie schniefte. »Sie hat meinen Vater zugrunde gerichtet. Wie ist sie umgekommen?«
Themenwechsel. Diese Frage kam für mich unvorbereitet.
»Man hat sie erdrosselt.«
Sophie blieb ruhig. Ich staunte über ihre plötzlich gefasste Haltung. »Kann ich meine Mutter noch einmal sehen?«
»Ich glaube, es ist besser, wenn Sie warten, bis Ihr Vater zurück ist.« Um die nächste Frage kam ich nicht herum. »Was haben Sie von gestern Abend bis heute Morgen gemacht?«
»Das ist wohl ein Scherz?« Sophie schaute mich verblüfft an.
»Ich muss alles in Erwägung ziehen«, antwortete ich. »Das bringt leider mein Beruf mit sich.«
»Ich war da in der Wohnung.« Sie zog die Augenbrauen hoch und spitzte den Mund, tat, als wäre sie sehr überrascht.
»Allein?«, fragte ich.
»Nein, nicht allein. Mit einem Lover. Wir haben die ganze Nacht durch…«, sie schmunzelte und schaute mich mit einem kecken Blick an, »…gebumst.« Sie verschränkte ihre viel zu langen Arme. In diesem Moment kam sie mir wie eine riesige Spinne vor. »Sie sollten sich wieder mal rasieren«, sagte sie. Das veranlasste mich, im Spiegel neben dem Eingang unbemerkt einen Blick von meinem Gesicht zu erhaschen. Was ich da im Bruchteil einer Sekunde erkannte, liess die Frage offen, ob ich in den letzten Tagen zu wenig geschlafen hatte. Salomé. Ich musste mich im Krankenhaus nach ihr erkundigen, obwohl sie das nie gewollt hatte. Ich streckte Sophie meine rechte Hand hin, zog sie jedoch wieder zurück, als sie keine Anstalten machte, die Geste zu erwidern.
»Ersparen Sie sich das«, sagte sie stattdessen. »Solange Sie mich verdächtigen, bleiben wir Feinde.« Sie bückte sich, um ihre Hosenbeine über den hohen Schuhen zu ordnen, ein völlig sinnloses Vorhaben, wie mir schien. Dabei rutschte ihr kurzes Top über ihre linke Brust, die praktisch flach war. Sie hatte eine helle Haut und rosa Knospen. Ich dachte an eine berechnende Absicht, die hinter ihrer Bewegung steckte. Sie warf dann auch den Kopf provozierend in den Nacken, bevor sie sich wieder vor mir aufrichtete. Ihre Augen blitzten. Sie hatte ungewöhnliche Augen.
Im Hinausgehen drehte ich mich noch einmal um. »Hat Ihre Mutter im Krankenhaus gearbeitet?«
Sophie reagierte schneller als erwartet. »Nein. Von Blut wurde ihr schlecht.«
Ich ging. Mein Hemd war nass vor Schweiss und dies nicht nur der Hitze wegen.
***
Ich hätte das Recht gehabt, einen Dienstwagen der Kantonspolizei zu fahren. Eine dieser Zwei-Liter-Limousinen. Aber da mir nun einmal mein alter schäbiger Golf lieber war und ich aufgehört hatte, die Beulen an der Karosserie zu zählen, zeigten auch meine Arbeitskollegen viel Verständnis dafür. Die Versicherung zahlte längst nicht mehr.
Den Weg zum Kantonsspital nahm ich über meine bekannten Abkürzungen und war froh, dass ich wenigstens am Ziel gleich einen Parkplatz fand.
Das Krankenhaus war ein riesiger Bau aus den späten Sechzigerjahren und ragte über ganz Luzern. Seit Jahren war da oben eine Baustelle, und ich fragte mich, wie die Patienten bei so viel baulicher Tätigkeit genesen konnten. Es schien wohl eher so, als wären sie die Mitfinanzierer dieses ewigen Projektes.
In der Eingangshalle ging es geschäftig zu und her. Patienten kamen, Patienten gingen. Vor den Informationsschaltern standen die Leute Schlange. Es war auch hier drinnen schwül und roch stark nach Chloroform. Ich wusste nicht, wo ich mich hinbegeben sollte. Ich musste allerdings endlich Gewissheit haben, dass Salomé hier war und noch lebte. Gleich würde sie mir um den Hals fallen, mich dafür schelten, dass ich, gegen unsere Abmachung, an ihren Arbeitsplatz gekommen war. Das würde nicht mehr wichtig sein, wenn ich sie nur sah und meinem inneren Kampf ein Ende bereiten konnte.
Die Schwester mit dem blauen Haarband kam gerade richtig. Ich stellte mich ihr in den Weg. »Hallo, haben Sie Zeit für mich?«
Sie zeigte ein zaghaftes Lächeln. Ihre Augen rollten unsicher. Eine Schwesterschülerin, ahnte ich und ich hielt sie sachte am Ärmel fest, damit sie mir ja nicht entkommen konnte. »Sie können mir sicher helfen. Ich suche Schwester Salomé.«
Die junge Frau mit dem Haarband nahm eine abwehrende Haltung ein. »Ich bin noch nicht so lange hier«, sagte sie und ihr Lächeln verstärkte sich noch ein wenig.
»Aber können Sie mir wenigstens sagen, wo ich mich nach ihr erkundigen kann?«
»Da gehen Sie am besten zur Anmeldung«, sagte sie und bewegte ihren Kopf in die Richtung, in der die Leute Schlange standen. Ich bedankte mich und stellte mich bei der Anmeldung hinten an.
Zwei Krankenpfleger eilten mit einer Bahre Richtung Ausgang, wo soeben ein schwarzes Taxi gehalten hatte. Hinter mir stellten sich weitere Personen in die Reihe. Ein kleines Mädchen hielt tapfer seinen Teddy im Arm und unterdrückte ein paar Tränen. Ich sah es an seinem zuckenden kleinen Mund. Die grosse, geschminkte Frau, bestimmt seine Mutter, beachtete es kaum und redete stattdessen ununterbrochen mit ihrer Nachbarin. Ich schaute die Kleine an, weil sie mir in diesem Moment leid tat. Als sich bei ihr doch eine Träne löste, nahm ich rasch ein Taschentuch aus meiner Hosentasche und gab es dem Kind. Ich erntete dafür ein dankbares Lächeln.
»Wie heisst du?«, fragte ich leise und kauerte mich vor ihm hin. Aber bevor mir das Mädchen Antwort geben konnte, riss es die Frau von mir weg. Langsam begann ich doch, an meinem Aussehen zu zweifeln.
Die Dame bei der Anmeldung war künstlich nett. Sie konnte mir auch meine Frage schnell beantworten. »Salomé hat soeben ihre Arbeit angetreten«, informierte sie mich, nachdem sie einen prüfenden Blick auf den Computer-Bildschirm geworfen hatte. »Sie finden sie im ersten Stock im Ambulatorium.«
»Ich dachte, sie habe Nachtdienst?«
Die Sekretärin schaute mich lächelnd an. »Vielleicht ist sie anders eingeteilt worden.«
»Können Sie bitte auch nachschauen, ob eine Catherine Mahler hier arbeitet oder gearbeitet hat?« Vielleicht kannte ich ihre Antwort bereits.
Ihre rechte Hand fegte die Maus über das Pad. Klickte an. »Nein, tut mir leid.« Sie fragte nach keinem Grund, was mich irritierte. »Sie müssen gehen. Sie sehen ja, was los ist«, sagte sie jetzt nicht mehr künstlich.
»Ist das immer so?«
»Ja, das ist immer so«, seufzte sie. »Die Krankheit nimmt keine Rücksicht auf Jahreszeiten.«
»Wenigstens gibt es hier keinen Stellenabbau«, sagte ich.
»Das liegt nicht in meiner Hand, auf Wiedersehen.«
Das war eine klare Aufforderung. Ich bedankte mich und ging. Vielleicht lag es schlussendlich doch in ihrer Hand.
Ich begab mich in den hinteren Bereich zum Aufzug. Es roch nach Sterilium, nach gewachsten Linoleumböden, nach Milchkaffee. Die beiden Krankenpfleger kehrten mit der Trage zurück, auf der jetzt ein Patient lag, und verschwanden in einem der Aufzüge.
Wenig später standen wir uns gegenüber: ich und eine mollige kleine Frau mittleren Alters mit einem kugelrunden, gutmütigen Gesicht und Wangen, die wie Äpfelchen im Herbst kurz vor der Ernte rot glänzten.
»Wo finde ich Schwester Salomé?«
»Haben Sie sich schon angemeldet?« Die erfahrene, emsige Art einer Alteingesessenen. Wenn sie sprach, kam dies einem Donnern gleich.
»Ich bin wegen Schwester Salomé hier«, berichtigte ich.
»Sie stehen vor ihr.« Wenn sie lachte, bebten ihre Falten auf dem vollen Gesicht. Da Vinci hätte die grösste Freude an ihr gehabt.
»Die Frau, die ich suche, ist ein wenig jünger als Sie«, versuchte ich, höflich zu dokumentieren.
»Wir haben sonst keine andere Angestellte mit diesem Namen hier im Haus. Und ich kenne mich aus, mein Lieber. Ich bin schon seit mehr als vierzig Jahren im Dienste der Kranken.«
»Aber vielleicht erinnern Sie sich an eine Krankenschwester mit langen, schwarzen Haaren ...« Ich hielt inne, weil mir in diesem Moment bewusst wurde, wie hilflos und komisch das klang.
»Ja?«, fragte sie. Ihr Mund klaffte vor Neugierde weit auf.
»Eine Schönheit von einer Frau«, sagte ich und verhaspelte mich. Ich bemerkte, welch eigenartigen Eindruck ich hinterliess.
»Wer sind Sie eigentlich, und weshalb suchen Sie die Frau?« Salomé griff nach meinem Arm und schob mich auf die Seite des Korridors, weil ein betagtes Paar an uns vorbeiging. »Ich ermittle in einem Mord«, flüsterte ich.
»Grosser Gott, und die Spur führt zu mir?« Sie schaute mich skeptisch an. Bevor ich mich auf eine Diskussion einliess, suchte ich jedoch das Weite. Ich bedankte mich mit ausgesucht netten Argumenten, entschuldigte mich für meinen Irrtum.
Ich fühlte mich so elend, als wäre ich soeben auf das fiese Vorgehen eines Komplotts gegen mich aufmerksam geworden. Die Leere, die ich schon am Morgen verspürt hatte, kehrte zurück. Ich hatte in meiner Tätigkeit als Kriminalbeamter grundsätzlich gelernt, über den Dingen zu stehen und Distanz zu wahren, und merkte jetzt unweigerlich, dass diese Prinzipien an Boden verloren, wenn persönliche Aspekte in den Vordergrund traten. Da nützte einem auch die Fähigkeit nichts, Dinge des Lebens einzugrenzen und voneinander zu unterscheiden. Noch einmal versuchte ich, meine Salomé zu erreichen, hatte aber wieder kein Glück.