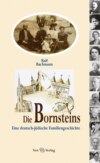Читать книгу: «Die Bornsteins», страница 2
Man sprach nur über Opas Streiche
Viel mehr über ihn weiß ich nicht. Er war schon sehr hinfällig, als ich gerade mal zu denken anfing. Noch einmal entlockte ich ihm ein herzliches Lachen, als ich ihn »Opa Bornsteibein« anredete. Ein einziges Foto zeigt mich mit ihm zusammen vor dem Kaufmannsladen meines großen Bruders beim Geschäfte machen. Das konnte er und das bereitete ihm Vergnügen, und wenn er einen anderen dabei über den Tisch zog, dann nicht aus Geldgier, sondern eher, ums dem mal zu zeigen.

Zeitgenössisches Flugblatt: Die fünf durch Hoelz niedergebrannten Villen in Falkenstein. April 1920
Großvater Max war in Falkenstein zu Lebzeiten eine fast ebenso bekannte Persönlichkeit wie sein Vornamensvetter Hoelz. Und er war auch nicht weniger populär. Er galt als Ulknudel, die viel Schabernack auf Kosten anderer betrieb, den Schaden aber meist in großzügiger Weise wieder gutmachte. Kein Heimatforscher hat darüber geschrieben, nichts Gedrucktes ist zu finden. Aber als ich mich in den Achtzigerjahren zum ersten Male in Falkenstein auf die Suche nach Spuren von Max Bornstein machte, vermochten sich einige sehr alte Leute noch an dies und das zu erinnern. Die Stammtisch- und Skatbrüder konnten sich ihre Zusammenkünfte ohne ihn nicht vorstellen. Noch Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden, so erzählte man mir, sagte man bei ihnen statt des üblichen Skatwortes »Die Hose runter« nur »ToT«, eine Abkürzung des Jiddischen »Toches offn Tisch«. Das hatten sie bei Max gelernt. Dann und wann nippte er wohl auch ein wenig am Glase. Meine Mutter sang gern das Lied vom »Bummelpetrus«. Ob sie da an ihn dachte, weiß ich nicht. Als Opas Lieblingslied, das er in der für ihre Stille bekannten Falkensteiner Nacht manchmal zum Entsetzen braver Bürger in voller Lautstärke zu intonieren pflegte, nannte sie jenes von der »tollen Bolle«: »Und dann schleich ich still und leise immer an der Wand lang, immer an der Wand lang, heimwärts von der Bummelreise, immer an der Wand, an der Wand entlang.«

Opa Max (ganz rechts) mit alten Freunden beim Skat
Nein, ein Vorbild war er nicht. Hätte es damals einen Stadtschreiber gegeben, Großvaters Streiche hätten ihm reichlich Stoff geboten. Es ist anzunehmen, dass sich die Reporter der Klatschpostillen, die gab es damals noch nicht und schon gar nicht in Falkenstein, oft an seine Fersen geheftet hätten. So sind wir auf Ortsgeflüster angewiesen, das ich noch durch die wohl eher geschönten Erzählungen meiner Mutter ergänzen kann. Da nichts mehr zu beweisen ist, muss man auf allzu detaillierte Schilderungen verzichten. Es gab in Falkenstein einen jüdischen Gemischtwarenladen, der einem als knausrig geltenden Freund oder Verwandten gehörte. Als der einmal in Chemnitz war und ihn seine nicht übermäßig fachkundige Gattin Selma im Laden vertrat, stattete Großvater dem Geschäft wie von ungefähr einen Besuch ab. Er sah sich dieses und jenes an und fragte dann beiläufig nach dem dunkelgrünen Inhalt eines kleinen Fässchens. Was das wohl sei, wollte er wissen. Weiß der Teufel, antwortete Selma. Koscher sieht es nicht aus, wie Schmierseife. »Na, dann gib mir mal für’n Groschen.« Selma verkaufte ihm eine ganze Schüssel voll. Unterwegs traf Opa ein paar Stammtischbrüder und schickte sie auch zu ihr. Im Nu war das Fass leer. Stolz berichtete Selma dem heimkehrenden Gatten über ihren Geschäftserfolg. Doch dessen Begeisterung hielt sich in Grenzen. Das »grüne Zeug« war nämlich Kaviar.
Die zweite Geschichte könnte Tante Gustel (Levy-Korytowski) widerfahren sein, deren Geschäft ja schräg gegenüber dem Wohnhaus meines Großvaters auf der anderen Straßenseite lag. Sie pflegte ihr Kinderwagenangebot zum Ärger mancher Spaziergänger als eine Art Fahrzeugkolonne auf dem Fußweg auszustellen. Aus Sicherheitsgründen und da die Straße leicht abschüssig war, fesselte sie alle mit einem Strick aneinander, den sie an einem eigentlich für Hundeleinen bestimmten Haken am Schaufenster festknotete. Als Opa festgestellt hatte, dass sich Tante Gustel zum Mittagsschlaf niederlegte, schlich er sich – Max und Moritz in einer Person – mit einem Messer über die Straße, schnitt den ganzen Geleitzug ab und setzte ihn in Bewegung. Manche Passanten fanden Vergnügen daran, die mutterlosen Wagen noch ein Stück weiter zu schieben. Jedenfalls grämte sich Gustel fast wie die Witwe Bolte und hatte den Rest des Nachmittags zu tun, um die alte Ordnung wiederherzustellen. Den Täter hatte sie schnell ausgemacht und drohte mit einem Regenschirm vom Haus 30 in Richtung Haus 9. Aber die Strafe kam nicht wie bei Wilhelm Busch in alttestamentarischer Härte. Lange böse sein konnte dem Opa kein Mensch. Der lud sich gleich bei ihr zum Kaffee ein, erzählte ein paar Schnurren und gelobte »beim Wohle meiner Kinder, mögen sie 120 Jahre alt werden«, so etwas werde sich nie wiederholen.

Anzeige aus dem Falkensteiner Adressbuch, 1907
Wenig zart spielte er auch dem Schmied, der zu seinem Stammtisch gehörte, bei einem gemeinsamen Berlin-Ausflug mit. Für Falkensteiner war ein Besuch in Berlin etwas Großes, und Opa Max wollte dem wohl noch die Krone aufsetzen, als er sie ins Hotel »Adlon« führte, dieses stinkfeine Haus mit dem Duft der großen weiten Welt und dem etwas aufdringlicheren der Halbwelt. Man setzte sich dort an einen Tisch im riesigen Restaurant mit den glatten Marmorfliesen, bestaunte die mondäne Garderobe und das extravagante Auftreten der Hautevolee der Reichshauptstadt, nippte an Kaffee oder Bier und fühlte sich sehr unsicher in der fremden, unheimlichen Umgebung. Mein Opa tat so, als ob er einmal für kleine Jungs müsse, flüsterte aber heimlich dem Oberkellner etwas ins Ohr und legte ihm ein Geldstück in die Hand. Bald wurde über »Hausfunk«, dessen ehrfürchtig verfolgte Durchsagen bis dahin dem Herrn Rittmeister und wirklichen Geheimen Rat von Sternberg, dem Herrn Akademiepräsidenten Prof. Dr. von Stubenrauch und der Operettensängerin Fräulein Fritzi Massary galten, ausgerufen: »Der Herr Schmied aus Falkenstein möchte bitte sofort zu Hause anrufen. Das Schmiedefeuer ist ausgegangen.« Der aus seiner Anonymität Gerissene lief puterrot an, schlurfte, alle Blicke auf sich ziehend, erschrocken über die Fliesen in Richtung Rezeption und merkte den Schwindel erst am schallenden Gelächter der Mitgereisten, die inzwischen Mitverschwörer und froh waren, dass es sie diesmal nicht getroffen hatte.
Jüngst kam mir noch eine andere Episode zu Ohren. Onkel Max fuhr mit Schwager Julius im Zug nach Leipzig. Der hatte die Gewohnheit, im Coupé als Erstes die Schuhe auszuziehen und als Zweites einzuschlafen. Als er dieses Stadium erreicht hatte, nahm Opa einen der Schuhe und band ihn außen an die Abteiltür. Vor Leipzig weckte er Julius auftragsgemäß. Der suchte vergeblich nach dem fehlenden Schuh. Großvater wusste natürlich von nichts. Aber der Schwager reagierte auf nicht erwartete Art. Er nahm den verbliebenen Schuh, öffnete das Fenster, warf ihn hinaus und zürnte: »Dann brauche ich den auch nicht mehr.« Spätestens beim Aussteigen dürfte er das bitter bereut haben. Vielleicht hatte er wenigstens zwei Paar Socken an. Opa besaß nach eigener Aussage nur ein einziges und begründete das mit dem überzeugenden Argument: »Was brauche ich zwei Paar Socken, wenn ich nur ein Paar Füße habe.«
Opa Max tat auch viel Gutes. Seine Kinder hatten durch seine Großzügigkeit eine solide Pensionatsbildung und verdankten ihm den besten Start ins Leben. In den Erinnerungen der Alten, mit denen ich sprach, die es aber auch nur von ihren Eltern wussten, spielten erlassene Raten und geschenkte Schuhe eine Rolle, wurde er ein Wohltäter genannt. Aber wie das so ist, von seinen Streichen war zu Hause oft, davon aber nie die Rede.
2. Kapitel
Aus dem Führer-Depot ins Musée d’Orsay
Die Geschichte eines Makart-Gemäldes oder: Wo man dem Abschiedsgruß der Lewins in Paris begegnet
Das Museum Orsay in der Rue de Lille ist eines der jüngsten in der französischen Hauptstadt. Erst 1986 wurde der Umbau eines schmucken Belle-Époque-Bahnhofs an der Seine in eine faszinierende moderne Bildergalerie abgeschlossen. Aber meine Cousine Ruth, die beste Fremdenführerin für Kunstliebhaber rund um Notre-Dame, pflegte zu sagen: Wer dieses Museum versäumt hat, dem bleibt wohl nichts übrig, als seinen Parisbesuch zu wiederholen. So führte sie meine Frau und mich gleich bei unserer ersten gemeinsamen Visite in der Metropole des Nachbarlandes dorthin, und wir sind ihr aus mehr als einem Grunde bis heute dankbar dafür. Nirgendwo sonst – den Louvre nicht ausgenommen – findet man die Werke der französischen Impressionisten in solcher Fülle und Vollständigkeit wie im Musée d’Orsay, nirgendwo hat man so viele beglückende Wiederbegegnungen mit alten Bekannten aus dem Schaffen von Manet und Monet, Renoir und Pissarro, aber auch von Cézanne und Gauguin, van Gogh und Toulouse-Lautrec wie in diesem auf die Zeit von 1848 bis 1914 beschränkten Musentempel mit dem gläsernen Bahnhofsdach.
Acht Meter Makart und eine Störung der Museumsordnung
Das Wirken des österreichischen »Malerfürsten« Hans Makart, der zwar kein Rembrandt war, aber mit Rubens zumindest die Vorliebe für pralle weibliche Rundungen teilte, fällt zwar in jenen Zeitraum, doch es ist wohl eher ein Zufall, wenn ihm in einem so französisch geprägten Museum auch ein Platz eingeräumt wurde. Nur diesem Zufall ist es zu verdanken, dass das Orsay in meine Sammlung deutsch-jüdischer Plaudereien geriet. Und dieser Zufall führte auch dazu, dass ich die Museumsordnung mit einer Blitzlichtaufnahme und die Museumsruhe – soweit man davon bei einem ununterbrochenen Strom zehntausender Besucher sprechen kann – durch einen Aufschrei störte. Es geschah beim Anblick der »Abundantia«, wie ich inzwischen weiß die römische Göttin des Überflusses. Das ist ein Gemäldepaar von über acht Metern Länge: vier Meter »Die Gaben der Erde« und vier Meter »Die Gaben des Meeres«. Da rief ich zwar unoriginell, aber absolut spontan und lauthals: »Ja kann denn das wahr sein?« Unter den »Gaben des Meeres«, einer Gruppe üppiger Damen mit Kindern, Netzen und Meeresfrüchten, zu deren bräunlich getönten Farben als Blickfang der nackte Rücken einer der Fischerinnen kontrastiert, hatte ich in meiner Jugend so manche Mußestunde verbracht und mich in schlüpfrigen Träumen als Gespiele der wohl nicht nur Fische fangenden Schönen gefühlt. Das Bild über der Couch in unserer Stube war freilich kleiner, eine Kopie, nach Ansicht von Kunstkennern die beste, das Werk eines jüdisch-ungarischen Malers namens, wenn ich nicht irre, Boris Birnenbaum. Der Weg des Originals ist eine wahrhaft dramatische Geschichte, das Schicksal der Kopie nicht minder.
Im vornehmen Leipziger Musikviertel lebte ein schon altes, ehedem sehr wohlhabendes jüdisches Ehepaar namens Lewin, das sein Leben und sein Vermögen dafür angelegt hatte, kenntnisreich Werke der Malerei zu sammeln, die nun dicht an dicht alle Wände ihrer Wohnung bedeckten. Meine Mutter kannten die Lewins aus früheren Zeiten, als sie noch die Bornstein Hertha war. Sie gehörten wohl zu einem Zweig jener Familie Lewin, in die Rosa, jene Schwester meines Großvaters eingeheiratet hatte, die gemeinsam mit ihrem Mann Paul Lewin das Geschäft in Falkenstein übernahm.

Die Gaben des Meeres (Ausschnitt)
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit den Lewins jemals Kontakt hatten, bis es zu jenem Besuch kam, der der erste und der letzte zugleich werden sollte. Als das Kunstsammlerehepaar 1943 die Aufforderung zum »Transport« erhielt, beschloss es, nicht auf den deutschen Tod im Auschwitzer Gas zu warten, sondern den Zeitpunkt vorzuverlegen und damit selbst zu bestimmen. Vorher wollten die beiden gern wenigstens ein paar der Kunstwerke vor dem Zugriff der Nazis bewahren. So fragten sie meine Mutter – in aller Vorsicht aus einer Telefonzelle –, ob sie nicht, es sei die letzte Gelegenheit vor ihrer Abreise, an diesem Abend einmal zu ihnen kommen könnte, um ein Geschenk entgegen zu nehmen.
Doch es hätte praktisch Selbstmord bedeuten können, wäre sie als Jüdin, die ohnehin nur dank ihres nichtjüdischen Mannes noch nicht den gleichen Weg vor sich hatte, der Einladung gefolgt. So einigte man sich schnell auf meinen älteren Bruder und mich. Uns als »Mischlingen« konnte nicht viel passieren. Lewins empfingen uns still, aber freundlich. Lange erzählten sie uns ganze Essays über den Lebensweg von wertvollen Bildern aus ihrem Besitz und machten uns auf deren Besonderheiten aufmerksam. Dass sie beschlossen hatten, ihrem Leben unmittelbar nach unserem Besuch ein Ende zu setzen, ließen sie uns weder merken noch wissen.
Ich hatte damals noch nie einen Kunstsammler gesehen oder gar besucht, selbst in ein Kunstmuseum hatte mich bis dahin niemand mitgenommen. Wer hätte es tun sollen und können? So stand ich wie betäubt vor der überwältigenden Fülle an Schönheit. Fast war es zu viel des Besten. Noch ein Bild hätte an den Wänden keinen Platz mehr gefunden. Welche Farben! Welche Figuren! Welche Allegorien! Ich war beeindruckt und ratlos zugleich. Mein praktischer veranlagter Bruder fragte, was nun aus diesem Schatz werden solle. Sie schwiegen bedrückt und schlugen uns vor, nein, baten uns, einige von ihnen ausgewählte Bilder mitzunehmen. Museumsstücke, nach denen gefahndet werden würde, kamen nicht in Frage. Aber einen postkartengroßen, farbenfroh ölgemalten Hahn in einem kostbaren goldenen Rahmen und zwei schöne Grafiken von Bäumen und Landschaften drückten sie uns in die Hand. Und auch die Makart-Kopie legten sie uns trotz deren Dimension ans Herz. Sie sei so wertvoll wie ein Original, da Makarts »Fischzug«, wie sie das Ölgemälde nannten, in München verschwunden sei und wahrscheinlich überhaupt nicht mehr existiere. Lewins umhüllten das Bild mit einem Leinentuch und gaben es uns. In der elterlichen Wohnung bekam es einen Ehrenplatz, doch Freude an ihm hatten wir nie, da natürlich die Nachricht vom Tode des Ehepaares eintraf, ehe das Bild über dem Liegemöbel hing.
Und als meine Mutter nach dem Kriege aus dem KZ Theresienstadt zurückgekehrt war, bezog sie – Vater war gestorben, der Bruder und ich arbeiteten in anderen Städten – bald eine Ein-Raum-Wohnung.
Zum Appetitmachen in die Kellerbar
Für das Bild war auf Dauer beim besten Willen keine Wand mehr frei. Sie bemühte sich, es zu verkaufen, bekam aber nur Absagen: Das im Krieg zerstörte Leipziger Bildermuseum hatte damals weder Räume noch Geld. Kunstliebhaber stellten sich in den Hungerjahren auf das Sammeln von Kartoffeln um. Selbst der große Heinz Rühmann nahm bei seinen Auftritten im Leipziger Raum nur Honorare in beißbarer Form. Private Makart-Liebhaber, sollte es die in Leipzig gegeben haben, kannte meine Mutter nicht. In der Familie hob man vor dem ölreichen Riesenschinken mangels Platz und Kunstverstand abwehrend die Hand. So war sie froh, dass sich der Wirt des Leipziger Nachtlokals »Cottbusser Postkutsche«, den sie zufällig beim Zeitungskauf kennen gelernt hatte, spontan zu einer Besichtigung vor Ort bereit fand. Nach dem dritten Boonekamp – er hatte schwer gegessen und irgendwelche Verdauungsprobleme – schob er schließlich seinen kalten Zigarrenstummel vom linken in den rechten Mundwinkel und begann zu nicken. Ja, so etwas könne er sich für seine Kellerbar am Brühl als »Appetitmacher« schon vorstellen, meinte er mit der praktischen Philosophie des neureichen Kunstbanausen. Er bot ihr wohl 100 oder 200 Mark, auf den Pfennig genau hat sie uns das nicht berichtet, und das Bild verschwand in der »Postkutsche«.
Die Bar segnete lange vor der DDR das Zeitliche. Nur ältere Leipziger, die unter den verführerischen Meerjungfern und ihren vollen Busen und Netzen vielleicht einst den ersten Kuss tauschten, mögen sich noch an die Nachtlokalzeit des »Fischzugs« erinnern. Ich sah das Bild nie wieder.
Bis ich eben im Orsay-Museum völlig unerwartet dem Original gegenüber stand. Cousine Ruth, die Zeugin der aufregenden Wiederentdeckung war, sich sehr für die dramatische und teilweise rätselhafte Geschichte interessierte und im Gegensatz zu mir mit französischer Korrespondenz in Kunstangelegenheiten keine Mühe hatte, schrieb einen Brief an Museumsdirektor Henri Loyrette. Der Conservateur Général antwortete postwendend. So erfuhr ich vom wechselhaften Schicksal der beiden »Abundantia«-Gemälde, die 1870 als erstes wichtiges Auftragswerk Makarts entstanden waren, aber niemals, wie vom Auftraggeber eigentlich vorgesehen, im Speisesalon des neu erbauten Palais Hoyos in Wien aufgehängt wurden. Die Gründe sind unklar, Makart-Forscher Gerbert Frodl vermutet, es sei zu einem Streit zwischen dem Maler und seinem Kunden gekommen. Schon 1871 ging das Bilderpaar auf »Wanderschaft« durch verschiedene Galerien, war einige Zeit auch im Besitz des Berliner Bankiers Blumenthal und landete 1889 in der Neuen Pinakothek in München.
Warum Lewins vom Verschwinden des Originals ausge-gangen waren, erhellte der weitere »Lebenslauf« der Gemälde: Adolf Hitler hatte »Die Gaben der Erde« und »Die Gaben des Meeres« nach einem Besuch der Pinakothek ganz begeistert für sein persönliches Museum ausgewählt, das nach dem »Endsieg« in Linz entstehen sollte. Deshalb hatten die Nazis die Bilder rechtzeitig in einem Depot im Salzkammergut »in Sicherheit« gebracht und Nachrichtensperre über sie verhängt. 1951 wurde das Gemäldepaar vom »Collecting Point« München nach Frankreich transportiert und 1973 an den Louvre verkauft. Seit 1986 hängt es im Orsay-Museum. Wie schlecht das Geschäft war, das meine Mutter gemacht hatte, geht aus einer dem Schreiben beigelegten Anzeige von Sotheby’s London vom Juni 1997 hervor, wo eine Version der »Gaben der Erde« für 45 000 bis 55 000 Pfund zum Verkauf angeboten wird.
Weitere Recherchen und vor allem Informationen der Leipziger Judaistin Ellen Bertram, die in ihrem Buch »Menschen ohne Grabstein« zu finden sind, ermöglichten es mir, dieses Erlebnis in »Ich habe alles doppelt gesehen« noch einmal aufzugreifen und um einige Fakten anzureichern. Eine mir wichtige Passage daraus möchte ich hier zitieren: Aber eigentlich wusste ich so gut wie nichts von den Bildersammlern Lewin, die wir an jenem Abend zum letzten Male sahen. Meine schwachen Erinnerungen beschränkten sich auf die so reich bebilderte Wohnung, die Freundlichkeit und das grenzenlos scheinende Fachwissen der alten Leute, auf den nächtlichen Heimweg mit den großen Gegenständen und auf das Entsetzen, als wir bald darauf erfuhren, dass sich die Ehepartner und die Schwester der Frau kurz nach unserem Besuch mit Schlaftabletten das Leben genommen hatten. Ich vermochte mich weder an das Datum, noch an die genaue Adresse, noch an das Lager zu erinnern, in das sie kommen sollten, von anderen interessanten Fragen ganz abgesehen, die mir bis heute unklar sind: Warum haben sie gerade bei meiner Mutter angerufen, wie verwandt waren sie mit den Bornsteins, wie sind sie zu den Bildern gekommen? Sie wussten natürlich noch nichts über das von Albert Speer nach Hitlers Plänen entworfene gigantische »Führermuseum«. Erst im April 1943 wurde darüber in der Zeitschrift »Kunst dem Volk« offiziell berichtet. Aber kannten sie vielleicht zufällig Dr. Gottfried Reimer aus Döbeln, einen der Chefbeschaffer für Linz, oder was ist sonst aus ihrer gewiss bedeutenden Sammlung geworden?
Aus dem Verzeichnis in »Menschen ohne Grabstein« konnte ich nun immerhin entnehmen, dass es sich um das Ehepaar Käthi und Fedor Lewin handelte, er am 17.6.1868 in Zibelle (Schlesien), sie am 1.11.1878 in Hannover als Tochter des Ehepaars Isenstein geboren. Käthi Lewin starb am 3.9.1942, Fedor zwei Tage später im Israelitischen Krankenhaus Leipzig. Sie hatten den Freitod gewählt, nachdem sie die Mitteilung über ihre Deportation nach Theresienstadt erhielten. Ellen Bertram ergänzte per E-Mail: »Mit großem Interesse habe ich in Ihrem Buch die Hinweise zur Kunstsammlung von Fedor Lewin gelesen. Es ist das einzige, was es dazu gibt bzw. was ich gefunden habe. Vor Jahren war mal ein junger Mann auf der Suche danach, ich habe aber nie wieder etwas von ihm gehört. Fedor Lewin hat schon vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Leipzig gelebt. Er war Inhaber der Firma Max Löwenberg & Co., Großhandel mit Damenbekleidung, der Firma Franz Wulf Nachf., Kleiderstoffgroßhandlung, und der Firma Schottländer & Co., Kleiderstoffgroßhandlung.«
Welchen Nutzen haben diese Details, die an der Geschichte im Prinzip nichts ändern? Nun, erstens verifizieren und konkretisieren sie das allein aus dem Gedächtnis Erzählte, zweitens korrigieren sie ein paar offensichtliche Irrtümer, drittens könnten sie dazu beitragen, dass sich der eine oder andere Nachkomme von Zeugen meldet und die noch offenen Fragen beantworten hilft. Den Verbleib der Lewinschen Sammlung zu klären, hieße ja wahrscheinlich nicht zuletzt, nazistischen Millionendieben auf die Spur zu kommen. Die Arbeit Ellen Bertrams und aller anderen, die sich die Erforschung jüdischer Schicksale zur Lebensaufgabe gemacht haben, hat also, wie dieses Beispiel zeigt, nicht nur rein moralische und wissenschaftliche, sondern auch ganz praktische Bedeutung und verdient umso mehr Lob und Anerkennung.
Бесплатный фрагмент закончился.