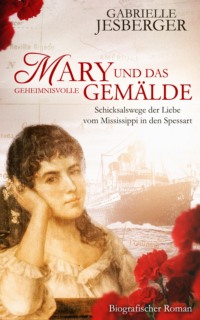Читать книгу: «Mary und das geheimnisvolle Gemälde», страница 4
Auch die Kirche war informiert, wie ein Appell vom 16. Juli 43 des Bischofs Wurm - der schon 1940 gegen das Euthanasie-Programm protestierte - an Hitler beweist: […] Die Liebe zu meinem Volk, dessen Geschicke ich als 75-Jähriger seit vielen Jahrzehnten mit innerster Anteilnahme verfolge und für das ich im engsten Familienkreis schwere Opfer gebracht habe, drängt mich aber dazu, es noch einmal mit einem offenen Wort zu versuchen. […] Für die lebenden, wie für die gefallenen evangelischen Christen Deutschlands wende ich mich als ältester evangelischer Bischof, des Einverständnisses weiter Kreise in der evangelischen Kirche gewiss, an den Führer und die Regierung des Deutschen Reiches. Nachdem die dem deutschen Zugriff unterliegenden Nichtarier in größtem Umfang „beseitigt“ worden sind, muss befürchtet werden, dass nunmehr auch die bisher noch verschont gebliebenen „privilegierten Nichtarier“ erneut in Gefahr sind, in gleicher Weise behandelt zu werden. Insbesondere erheben wir eindringlichen Widerspruch gegen solche Maßnahmen, die die eheliche Gemeinschaft in rechtlich unantastbaren Familien und die aus diesen Ehen hervorgegangenen Kinder bedrohen. Diese Absichten stehen, ebenso wie die gegen die anderen ergriffenen Vernichtungsmaßnahmen, im schärfsten Widerspruch zu dem Gebot Gottes und verletzen das Fundament alles abendländischen Denkens und Lebens: Das gottgegebene Urrecht menschlichen Daseins und menschlicher Würde überhaupt. In der Berufung auf dieses göttliche Urrecht des Menschen schlechthin erheben wir feierlich die Stimme, auch gegen zahlreiche Maßnahmen in den besetzten Gebieten. Vorgänge, die in der Heimat bekannt geworden sind und viel besprochen werden, belasten das Gewissen und die Kraft unzähliger Männer und Frauen im deutschen Volk auf das schwerste; sie leiden unter manchen Maßnahmen mehr, als unter den Opfern, die sie jeden Tag bringen. Und in einem weiteren Appell im Dezember 1943: […] dass wir als Christen diese Vernichtungspolitik gegen das Judentum als ein schweres und für das deutsche Volk verhängnisvolles Unrecht empfinden. Das Töten ohne Kriegsnotwendigkeit und ohne Urteilsspruch widerspricht auch dann dem Gebote Gottes, wenn es von der Obrigkeit angeordnet wird, und wie jedes bewusste Übertreten von Gottes Geboten rächt sich auch dies früher oder später. Diese Appelle wurden von Hitler nicht beantwortet und blieben vorerst ohne Folgen, da sie nicht in den Kirchen verkündet wurden. 1944 erhielt Bischof Wurm allerdings Schreib- und Redeverbot. Über den Rundfunksender London wurden die Appelle jedoch in norwegischer Sprache verbreitet. (Der Originalbrief kann im Internet unter „evangelischer Widerstand“ nachgelesen werden.)
Dass viele Deutsche den späteren Verschwörungstheorien der Holocaustleugnung gerne Glauben schenkten, ist aus psychologischer Sicht nicht verwunderlich. Damit konnte man den unvorstellbaren Vorwurf, Hitler sei ein millionenfacher Massen- und Kindesmörder gewesen, als Lüge der Siegermächte darstellen und sein eigenes Gewissen beruhigen, Hitler als von Gott gesandten Retter der deutschen Nation stilisiert zu haben und ihm bedingungslos gefolgt zu sein. („In Auschwitz wurde niemand vergast“, Friedrich-Ebert-Stiftung, entlarvt sechzig häufige Lügen, s. Literaturverzeichnis.)
In Abwandlung des Songtextes von Marlene Dietrich "Sag mir, wo die Blumen sind ...", wird die Frage nach dem Verbleib der Juden gestellt: "Sag mir, wo die Juden sind, wo sind sie geblieben? Über Gräber weht der Wind. Wann wird man je versteh'n?"
Die Nazis hatten eine "doppelte Buchführung" in Form eines eigenen Registers. Ihre Namen müssten in den weltweiten Datenbanken oder in den Opferdatenbanken zu finden sein.
Jeder einzelne unserer Generation muss sich allerdings die Frage stellen, ob er selbst der Verführung widerstanden hätte. Ein weiterer Versuch, das eigene Gewissen zu entlasten ist der Verweis auf Kriegsverbrechen anderer Völker. Der Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen Russland forderte den höchsten „Blutzoll des Zweiten Weltkrieges“ mit mindestens zwanzig Millionen Toten in der Sowjetunion (gegenüber sechs Millionen Deutscher). Dieser Zusammenhang als Ursache für russische Racheakte wurde und wird einfach unter den Teppich gekehrt und nur von den „bösen“ Russen gesprochen.
Der alte Spessartdoktor
Wie eine gefällte Eiche, deren Blätter und Zweige kraftlos wurden und langsam verdorrten, schwand Richards Vitalität. Ihm war, als ob ein Mühlstein auf seiner Brust läge. Gebeugt und mit schwerem Schritt stützte er sich auf seinen Stock. Er, der zeitlebens vor Ideen und Humor gesprüht und meist mehrere Projekte gleichzeitig verfolgt hatte, wurde immer schweigsamer, als fehlten ihm auf einmal die passenden Worte. Immer öfter fand Else ihren Vater gedankenverloren in seinem Lehnstuhl sitzend, den Kopf auf seine Hand gestützt, als ob er ihm durch all die verwirrenden Gedanken zu schwer geworden wäre. Sein langer Bart war weiß geworden wie sein schütteres Haar. Seine hellen blauen Augen hatten ihren Glanz verloren. Er, der immer so gerne Konversationen geführt, dem man in geselliger Runde gerne zugehört hatte, wurde immer stiller. Er, der von einer plötzlichen Inspiration, selbst von jedem neuen Gedankenblitz so berauscht schien, dass er nie an seinem Erfolg gezweifelt hatte und dem es so mühelos gelungen war, seine Umgebung damit in den Bann zu ziehen, dass es der eigenen Familie manchmal sogar zu anstrengend wurde, ihm in seinen Gedankengängen zu folgen, wurde mit einem Mal bei alltäglichen Dingen unsicher. Richards Sprachlosigkeit wurde mehr und mehr zu einem Gefängnis, in das die Familie kaum noch eindringen konnte.
Dem Zusammenbruch seines Weltbildes, der Richard in seinen Grundfesten erschütterte, folgte ein Rückzug, in dem er sich immer häufiger nur noch danach sehnte, die quälenden Gedanken vergessen zu können. Wie gut, dass Mary diese Schreckenszeit nicht mehr erleben musste. Nach und nach legte sich der besänftigende Schleier des Vergessens über seine Verzweiflung und erlöste mit der Zeit die quälende Unruhe in ihm.
Durch die Dominanz der väterlichen Pastorenfamilie mit dem lutherischen Antisemitismus und der evangelischen Erziehung seiner eigenen Kinder stand dieser Geist der Familie Wehsarg in der Villa Elsava im Vordergrund. Im Dritten Reich wurde die gegensätzliche liberal-demokratisch katholische Einstellung der Familie Wagner verschwiegen. Sie passte nicht in den Zeitgeist und wurde den nachfolgenden Generationen so lange nicht vermittelt, bis die Familiengeschichte des Dr. Franz Wagner ans Licht geholt wurde.
Annemarie bemerkte als erste, dass Opapa auffällig oft rastlos mit hängendem Kopf durch die hohen Räume der Villa ging, als ob er etwas suchen würde. Auf ihre Frage schüttelte er nur stumm den Kopf und schaute zu Boden. Ein andermal redete er zusammenhanglos von der Eisenbahn und als Mie auf ihn einging, sich bei ihm einhakte und ihn auf dem Weg „zur Bahn“ begleitete, indem sie die „Reise nach Jerusalem“ mit ihm spielte, mehrmals mit ihm im Salon um den großen Tisch ging, um sich dann - wie im Abteil des Zuges - auf zwei nebeneinander stehende Stühle zu setzen, drückte er mit einem glücklichen Lächeln wortlos die Hand seiner Enkeltochter. Sie wusste, jetzt fuhr er in seiner geliebten Spessarteisenbahn.
Bevor Lilo zurückging in die Küche schaute sie durch das hohe Fenster zum Park und konnte gerade noch sehen, wie Wolfgang eine Ziege an der Leine führte, die jüngere trottete hinterher und Udo versuchte sie mit lautem „Maxi“-Rufen und einem Stock in die richtige Richtung zu treiben. Sie ließen sich nicht die Zeit, ihre Schuhe anzuziehen und liefen barfuß auf die Wiese zu, die hinter dem Park lag. Ein Anblick, an dem sich Lilo gar nicht sattsehen konnte. Wie gut, dass die beiden heute ihre robusten kurzen Lederhosen angezogen haben! Inge, die gerade eben noch mit der kleinen Katze gespielt hatte, bemühte sich, sie einzuholen.
Rechtzeitig zum Abendessen kamen die drei mit einem Mordshunger zurück. Schweigend, wie von Papi gefordert, saßen sie am Tisch. Ihre Ungeduld konnten sie allerdings kaum zügeln. Udo baumelte so heftig mit den Beinen unter dem Tisch, dass er an die Stuhlbeine schlug und ein lautes rhythmisches Stakkato die Stille unterbrach. Inge half ihrer Mutter und Tante Lilo in der Küche. Wolfgang rutschte auf seinem Platz hin und her, bis Papi einen strafenden Blick über den Tisch schickte und mit energischem Blick erwartungsvoll in Richtung Küche schaute. Wo blieb Lilo nur mit dem Abendessen?
Opapa, der sich nach seinem Mittagsschlaf regelmäßig in den Malepartus zurückzog, um ungestört seine Pfeife mit dem eigenen Tabak zu genießen, den er selbst im Garten angepflanzt hatte und der zum Trocknen auf einer langen Leine im Speicher hing, war noch nicht zurückgekommen, obwohl es schon dunkel wurde. Seine Tochter fand ihn gedankenversunken im Lehnstuhl am Fenster. Sanft berührte sie ihn an der Schulter: „Papa, hast du noch keinen Hunger? Komm, lass uns ins Haus gehen!“ Als er aufschaute, schien sein Blick ins Leere zu wandern. „Ich warte noch auf mein Knüddelchen“, flüsterte er kaum hörbar. Else erschrak. Wurde ihr Vater jetzt noch verwirrter? Dann fasste sie sich, half ihm auf, hakte sich bei ihm unter und bemühte sich, heiter zu wirken: „Du weißt doch, Papa, wo sie ist, wir gehen zu ihr!“ Seit dem Tod ihrer Mutter vor nun bereits sechsundzwanzig Jahren ging ihr Vater nie schlafen ohne zuvor an die Vitrine zu treten, auf der die Urne mit der Asche seiner verstorbenen Frau auf einem zarten Spitzendeckchen stand. Heute stützte er sich schwer mit einer Hand auf seinen Stock und der anderen auf dem tischhohen Sockel ab. Nachdenklich beobachtete Else, wie ihr Vater sehr lange seinen Blick auf dem Selbstportrait seiner Frau ruhen ließ.
Bevor sie am Abend zu Bett ging, öffnete sie leise die Türe zum Zimmer ihres Vaters. Sie war besorgt, weil er keinen Appetit hatte und das Abendessen stehenließ. Lisbeth, das Hausmädchen hatte eigens einen Grießbrei gekocht, den er so gerne aß, aber an diesem Abend schien ihn auch der feine Zimtduft, der sich aus der Küche verbreitete, nicht zu locken. Im Lichtschein des Flures sah Else, dass ihr Vater mit offenen Augen und wie zum Gebet verschränkten Händen im Bett lag. Vorsichtig trat sie zu ihm und strich ihm über die Schulter: „Geht es dir besser, Papa?“ Sie war nicht sicher, ob er sie überhaupt hörte. Er schien mit seinen Gedanken weit weg zu sein. Else setzte sich auf die Bettkante und wartete. Richard hatte die Augen geschlossen und nach ein paar Atemzügen, die ihm sichtlich Mühe machten, hörte sie ihn flüstern: „Ich komm‘ bald zu dir, mein Liebes!“
Noch vor ein paar Wochen hatte Opapa mitgeholfen beim Aufstapeln des Holzes für den Heizvorrat im Winter. Trotz seiner Beinamputation und der anderen - noch lange nicht verheilten - Kriegsverletzungen bemühte sich Willi, einen ganzen Ster Holz mit dem Beil in entsprechende Scheite zu hauen. Hochdekoriert war er vom Krieg zurückgekommen. Doch nun war er nur einer von vielen Kriegsinvaliden, ein junger Mann, kurz vor seinem einunddreißigsten Geburtstag, der die letzten Kräfte mobilisierte, um für seine Familie da zu sein. Doch der so sehnlich Erwartete, der endlich Heimgekehrte, schien oft nur körperlich anwesend zu sein. Lilo konnte es an seinen Augen ablesen, dass er das Erleben im Krieg noch nicht hinter sich gelassen hatte. Sie spürte seine stumme Ablehnung, wagte nicht weiter zu fragen, wenn er nur von der Verbundenheit mit seiner Kompanie und seinem Burschen berichtete. Seine aufkommenden Gedanken, erst jetzt, wo der Krieg beendet war, die Szenen, die ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf aufschrecken ließen, quälten ihn erbarmungslos. Wie es ihm möglich war, auf Menschen zu schießen, obwohl er wusste, das vorsätzliche Töten ist Mord und durch den Krieg war es mit einem Mal in Heldentum verwandelt, erschütterte ihn bis ins Mark. Schweißgebadet lag er Nacht für Nacht auf seinem Kissen. Seine Schweigsamkeit, seine Ungeduld, sein Jähzorn waren für Lilo und die beiden Söhne erschreckend. Willi war als Fremder zurückgekommen.
Nach dem Rausch des Wiedersehens bestimmten rasch die Sorgen um die Nahrung den Alltag. Lilo war täglich mit Wolfgang bei Bauern auf dem Kartoffelacker, um den Jahresvorrat anzulegen. Auch nach der Ernte waren die beiden nochmal unterwegs zum „Stoppeln“. Willi sortierte jeweils aus, was sie mitbrachten und sorgte für die angemessene Lagerung, damit keine Fäule entstehen konnte. Es musste Heu gemacht werden für die Ziegen, damit sie für die Kinder genügend Milch (nach Opapas Anweisung, der sie für nahrhafter und bekömmlicher hielt als Kuhmilch) geben konnten. Die neuen Hühner entpuppten sich als Hähne und so war die Sorge groß, überhaupt genügend Eier zu bekommen. Willi bat seine Schwester, zwei Hähne gegen Hühner einzutauschen. Von ihr hatte er auch eine junge Ziege und drei Hasen bekommen. Von denen allerdings schon bald zwei geschlachtet werden mussten, noch bevor sie Fleisch ansetzen konnten, weil sie durch eine Unverträglichkeit des Futters plötzlich gefährlich aufgebläht waren.
Als am Morgen alle zum Frühstück am Tisch saßen, aber Opapa fehlte, meinte Else halblaut mehr zu sich selbst: „Heute schläft Papa aber sehr lange, hoffentlich geht es ihm besser. Ich werde mal nach ihm schauen.“ Vorsichtig drückte sie die Klinke herunter und lugte leise durch den Türspalt in die Schlafstube ihres Vaters. Die Vorhänge waren noch zugezogen. Das Morgenlicht legte sanfte Schatten auf das Bett, in dem er ganz still, wie in einem tiefen Schlaf, zu liegen schien. Mit vorsichtigem Schritt - die Dielen knarrten leise unter ihren Füßen -, um ihn nicht zu wecken, ging sie näher. Ihr Vater lag noch so - mit verschränkten Fingern auf der Bettdecke -, wie sie ihn am Abend zuvor verlassen hatte, aber sein Gesicht war verändert. Als ob er gerade in einen schönen Traum versunken wäre, waren seine, in letzter Zeit so starr gewordenen, Gesichtszüge nun von einem sanften Lächeln erlöst. Abrupt blieb Else vor dem Bett stehen, augenblicklich wusste sie, ihr Vater war sanft eingeschlafen, er war von dieser Welt gegangen. Erschrocken wagte sie nicht, sich zu rühren. Das Mysterium des Todes ergriff sie. Nach einiger Zeit strich sie ihm schweigend über die Hände und erschrak über die Kälte, die bereits von ihnen ausging. Plötzlich standen Lilo und Annemarie neben ihr, ihre Ahnung hatte sich bewahrheitet. Obwohl sie alle auf seinen Tod vorbereitet waren, kam er nun doch ganz plötzlich und brachte die ganze Familie aus dem Gleichgewicht. Jetzt erst wurde ihnen bewusst, wie oft Opapa sie in den letzten Jahren unterstützen konnte durch seine reichen Erfahrungen, sein großes Wissen und seine guten Ratschläge, die ihm nie ausgegangen waren.
Gemeinsam mit Lisbeth, die Erfahrung darin hatte, Verstorbene auf ihre letzte Reise vorzubereiten, bahrten Else, Lilo und Mie ihren Vater und Opa auf, damit die ganze Familie, Freunde und Nachbarn sich von ihm verabschieden konnten. Willi und Ludwig hielten die Totenwache und wechselten sich ab mit Franz, der inzwischen von Aachen gekommen war. Am Abend begann das Kommen und Gehen. Es brach nicht ab in den nächsten beiden Tagen. Die unzähligen Beileidsbekundungen waren begleitet vom Dank und der Anerkennung für diesen großen Mann und Wohltäter des Spessarts. Wie ein Lauffeuer ging es durch die ganze Region: „Unser Spessartdoktor ist nicht mehr!“
An einem sonnigen Herbsttag war der kleine Friedhof am Hang hinter der alten Laurentiuskirche voll von Trauergästen, die ihm die letzte Ehre erwiesen. Die tief empfundenen Abschiedsworte am Grab wollten nicht enden. Mit seinem natürlichen selbstlosen Wesen hatte Richard die Herzen der Spessarter gewonnen und wird in ihren dankbaren Erzählungen auch in den nächsten Generationen noch weiterleben. Allen gemeinsam war der Dank und das Versprechen, dass sein segensreiches Wirken im ganzen Spessart unvergessen bleiben würde.
Nur die Familie wusste, die geliebte Frau an seiner Seite, die ihn in allem bis zu ihrem Tod rückhaltlos unterstützt hatte, hielt er nun mit den sterblichen Überresten in der Urne im Arm und wurde mit ihm der Erde zur letzten Ruhe übergeben. So bescheiden und selbstlos wie Mary an seiner Seite in seiner Wahlheimat lebte, hatte sie auch das letzte Abschiednehmen ihrer sterblichen Hülle von dieser Welt alleine ihrem geliebten Mann überlassen.
Teil 2
Teil 2
Badische Revolution und pfälzischerAufstand 1848/49
Die Auswirkungen der Französischen Revolution von 1789, unter dem Motto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, erschütterten die mitteleuropäische Staatenwelt. Zwischen 1798 und 1816 änderte sich auch für das Territorium der Pfalz mehrfach die Zugehörigkeit. Unter Napoleon fiel 1803 der linksrheinische Teil völkerrechtlich an Frankreich, der rechtsrheinische an das Großherzogtum Baden. Nach der Niederlage Napoleons und dem Wiener Kongress wurden 1816 die linksrheinischen Teile der ehemaligen Pfalz an Bayern zurückgegeben und bildeten die „neue Pfalz“. Die Bevölkerung nahm die Angliederung an Bayern zunächst freundlich auf, zumal der neue Landesherr, König Maximilian II., zusicherte, dass die Reformen der Napoleonischen Ära erhalten bleiben. Doch bereits nach einigen Jahren kam es - durch die in der Kriegszeit entstandene Schuldenlast und die ungünstige Zoll- und Forstpolitik der Staatsregierung - zu Spannungen. Diese spitzten sich zu, als die Regierung ab 1830 gegen fortschrittliche Zeitungen mit Zensur reagierte. Der nachfolgende Unmut fand in zahlreichen Protestaktionen Ausdruck, vor allem auf dem Hambacher Fest, das vom republikanisch-demokratischen und unterschwellig revolutionären Geist geprägt war.
Das Hambacher Fest, eine Demonstration, an der etwa dreißigtausend Menschen teilnahmen, fand vom 27. Mai bis 1. Juni 1832 auf dem Schloss Hambach statt und galt als Höhepunkt bürgerlicher Opposition in der Zeit des sogenannten „Vormärzes“. Heute ist es im Zusammenhang mit anderen Ereignissen, wie dem Wartburgfest 1817, der französischen Julirevolution 1830, dem polnischen Novemberaufstand und der belgischen Revolution 1830/31 zu sehen. Es kamen sehr viel mehr Menschen als erwartet. Ursprünglich rechnete Johann Wirth, Jurist und Journalist, der mit einem Kollegen das Fest organisiert hatte, mit etwa tausend Teilnehmern. Doch die Kunde hatte sich sehr schnell verbreitet. Nicht nur Studenten, die national dachten, sondern auch Kaufleute, Handwerker, Bauern, Tagelöhner, sozusagen das gesamte Volk war auf den Beinen. Außergewöhnlich für diese Zeit war, dass auch Frauen sich beteiligten, die sich allgemein politisch nicht betätigen durften. Sogar Gäste aus England, Frankreich und Polen reisten an, so dass es nicht mehr nur ein deutsches, sondern schon fast ein gesamteuropäisches Fest wurde. Alle riefen nach Freiheit und Demokratie und führten erstmals eine schwarz-rot-goldene Fahne mit sich. Die Aufschrift „Deutschlands Wiedergeburt“ im mittleren roten Teil machte das Ziel der Beteiligten deutlich, die Errichtung des Deutschen Nationalstaates. Überall wehten die schwarz-rot-goldenen Fahnen als Symbol für Freiheit und Einheit der Nation. Die Forderungen der zahlreichen Redner und Festteilnehmer nach nationaler Einheit, Freiheit und Demokratie, hatten ihre Wurzeln im Widerstand gegen die restaurativen Bemühungen des 1815 gegründeten Deutschen Bundes, die alten Verhältnisse beizubehalten. Unmittelbar nach seiner Rede wurde Wirth verhaftet. In den Fürstenhäusern ganz Deutschlands weckten die Ereignisse um das Hambacher Fest Zweifel, ob die Wittelsbacher, mit ihrem Regenten Maximilian II., noch Herr der Lage wären.
Der junge Franz Wagner kam aus einer alteingesessenen, angesehenen Mainzer Familie. Sein Vater war als Großherzoglicher Medizinalrat und Kreisarzt eine stadtbekannte Persönlichkeit. Nach seinem Abitur hatte Franz in der „Freistadt Frankfurt“ ein Jurastudium begonnen. Für den angehenden Student der Rechte stand das liberale Gedankengut seiner Professoren an der Universität in krassem Gegensatz zu der Haltung seines Vaters, von der er sich immer mehr entfernte. Auch die Mutter beobachtete die Entwicklung ihres Sohnes mit Argwohn. In den Semesterferien schloss er sich einem Freund an, dessen Vater in der Agentur einer Rheinflößerei beschäftigt war. Ihre Abenteuerlust lockte sie, dort als zusätzliche Floßknechte anzuheuern. So konnten sie zum einen kostenlos an mehreren Rheinfahrten zu den holländischen Schiffswerften in Dordrecht teilnehmen und zum anderen sich ein kleines Taschengeld verdienen. Wegen ihres Zieles wurden die langen Flöße aus den harten Spessarteichen und den hohen Schwarzwaldtannen auch Holländerflöße genannt. Die Gesamtlänge eines solchen Floßes betrug bis zu 330 Meter, bei einer Breite von etwa 60 Metern. Wenn sich mehrere Lagen Baumstämme übereinander türmten, betrug der Tiefgang bis zu 2,5 Meter. Der Preis für den Stamm einer Tanne lag bei etwa 30 Gulden. Das für den Schiffsbau besonders begehrte Eichenholz hatte etwa den zehnfachen Wert von Tannenholz. Von Mainz aus starteten pro Tag etwa ein bis zwei Flöße. Auf der bis zu 20.000 Quadratmeter großen Oberfläche befanden sich Mannschaftsunterkünfte, Küchengebäude und Viehställe. Eine Floßbesatzung von 400 bis 500 Männern war keine Seltenheit. Vor Erreichen einer Flussbiegung und beim Anlanden fuhren kleine Boote voraus, um am Ufer Anker zu befestigen und verlangten die ganze Kraft besonders starker Männer. Bei dieser harten Arbeit waren die Flößer hohen Unfallrisiken ausgesetzt.
Der Reederei war die Abenteuerlust der beiden jungen Burschen als Ersatzkräfte willkommen. Nach einigen reibungslosen Floßfahrten entwickelte sich ein engeres Verhältnis zwischen der Agentur und Franz Wagner. Noch konnte er nicht ahnen, welcher Vorteil ihm eines Tages daraus entstehen sollte.
„Deine Abenteuerlust steht dir auf der Stirn geschrieben! Wenn sie dir nur nicht eines Tages das Genick bricht!“, rief sein Vater ihm nach, als Franz seine Jacke und Mütze packte und aus dem Haus stürmte. „Vater, sagst du nicht selbst oft, schon unser alter Geheimrat Goethe wusste: ‚Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun!?“, rief er in provozierendem Ton zurück, ohne auf eine Antwort zu warten.
Vier Wochen nach dem Hambacher-Fest, im Juni 1832, versammelten sich auf dem Sandhof in Frankfurt etwa 4000 freiheitsliebende Menschen mit der schwarz-rot-goldenen Kokarde am Revers zu einer Demonstration, um sich mit den Hambachern zu solidarisieren. Frankfurt war zu dieser Zeit Sitz des sog. „Bundestages“ des Deutschen Bundes (der vielen Fürstentümer bzw. Kleinstaaten). Ein Jahr später scheiterte der Frankfurter „Wachensturm“ auf die Hauptwache und Konstabler Wache, mit dem Ziel, eine allgemeine Revolution in Deutschland auszulösen. Er gehörte neben dem Wartburger und dem Hambacher Fest zu den spektakulärsten Aktionen des „Vormärzes“ und bereitete die Märzrevolution 1848 mit vor. Nahezu 200 Aufständische (Burschenschaften aus Würzburg und Heidelberg) stürmten die beiden Polizeiwachen, um sich der Waffen und der reichgefüllten Kasse des Deutschen Bundes zu bemächtigen. Zudem sollten die Gesandten der deutschen Fürsten, die in dem nahe gelegenen Palais der Thurn und Taxis tagten, gefangen genommen werden. Der Wachensturm sollte ein Signal zu einer nationaldemokratischen Erhebung für ganz Deutschland werden. Das Ganze war zum Scheitern verurteilt, da die breite Unterstützung aus dem Volk fehlte. Das Militär machte kurzen Prozess und hatte leichtes Spiel. Frankfurt wurde danach durch preußische und österreichische Truppen besetzt, ein Affront gegen die Freistadt. Dies machte die Truppen äußerst unbeliebt und so bekam die Revolution immer mehr Anhänger. Viele Verschwörer flohen vor der drohenden Verurteilung als „Dreißiger“ in die USA.
Nachdem im Jahr 1834 im nahen Aschaffenburg ein Anschlag auf den bayerischen König verübt wurde, zog die Obrigkeit wieder die „Daumenschrauben“ an. In einer Sitzung des Deutschen Bundes 1835 wurden die Schriften des „Jungen Deutschland“ der Hambacher verboten. Unter den Autoren war auch Heinrich Heine. Mit der Begründung, diese „junge Literatur“ würde die christliche Religion angreifen, die sozialen Verhältnisse herabwürdigen und alle Zucht und Sittlichkeit zerstören.
Nicht nur die Hambacher, sondern auch Freidenker in der Kultur wie z. B. die Gebrüder Grimm wurden von Repressalien nicht verschont. Neben Heinrich Heine, Georg Büchner und Hoffmann von Fallersleben gingen auch viele andere ins Exil. Letzterer veröffentlichte 1840 seine Gedichtsammlung „unpolitische Lieder“, in denen er sich kritisch mit den damaligen politischen Zuständen auseinandersetzte. Die preußische Regierung verbot prompt den Gedichtband, entzog ihm zwei Jahre später die Professur incl. der Pension und danach die preußische Staatsbürgerschaft. Als „Vormärzlyriker“ führte er nun ein Wanderleben quer durch die deutschen Kleinstaaten und wurde nahezu vierzig Mal ausgewiesen. 1841 verfasste er auf Helgoland das „Lied der Deutschen“ das in der dritten Strophe die Gedanken der Hambacher und damit des Franz Wagner besonders eindrucksvoll widerspiegelt und seit 1991 als Nationalhymne gesungen wird (Während der NS-Zeit, wurde das Lied missbraucht.):
Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand.
Blüh‘ im Glanze dieses Glückes,
blühe deutsches Vaterland!
Wirtschaftliche Krisen, Massenarmut und allgemeine politische Unzufriedenheit destabilisierten seit Beginn der 1840er Jahre die soziale und politische Ordnung in zahlreichen europäischen Staaten und mündeten 1848 schließlich in eine - ganz Europa erfassende - revolutionäre Welle. Die Aufsplitterung Deutschlands in 41 kleinere und größere Staaten und Fürstentümer und dem unvermeidlichen kostspieligen Hofstaat, den Beamten, die die einfachen Bürger ausbluten ließen, war nicht mehr zu verstehen und so nicht mehr hinzunehmen. Obwohl die Bürger durch Fleiß zu etwas Wohlstand gekommen waren, durften sie öffentlich nicht ihre Meinung sagen, sondern mussten der Obrigkeit gehorsam sein.
Trotzdem waren die Ideen der Freiheit und Gleichheit lebendig und so trafen sich 1848 viele Mutige auf unzähligen Versammlungen und Demonstrationen, um die Gewährung von Grund- und Freiheitsrechten und nationaler Einheit einzufordern. Unter dem Eindruck der revolutionären Dynamik gaben die Machthaber zunächst ihren Widerstand auf und machten der - von breiten Schichten getragenen - Bewegung wesentliche Zugeständnisse: Die Zensur wurde aufgehoben, politische Aktivitäten zugelassen und reformbereite Regierungen ernannt, auch die Einberufung einer Nationalversammlung versprochen, die die Errichtung eines deutschen Nationalstaates in die Wege leiten sollte.
Ausgehend von der Mannheimer Volksversammlung im Februar 1848 lauteten die Forderungen der Revolution: unbedingte Pressefreiheit, Schwurgerichte nach dem Vorbild Englands, sofortige Herstellung eines deutschen Parlamentes. In Württemberg, Hannover und Hessen-Darmstadt kamen die Fürsten rasch einigen Forderungen der Revolutionäre nach. Oftmals blieb es allerdings nur bei leeren Versprechungen. Die - in mehreren Ländern des Deutschen Bundes - entstehenden Unruhen, die gleichzeitigen Veränderungen im nahen Nachbarland Frankreich, wo König Louis Philipp die Reform des Wahlrechtes verhinderte, die mit der Vertreibung des Königs endete, entzündeten einen Funken, der sich wie ein „Feuersturm“ durch ganz Europa zog. Die über viele Jahre angestaute Wut über die Unterdrückung des Volkes fachte das „Feuer“ an und ließ vor allem junge mutige Männer in den Studentenkreisen unruhig werden. Die sog. „Märzrevolution“ (erste Revolutionsphase) erreichte am 18. März 1848 in Berlin ihren Höhepunkt und forderte über 400 Tote. König Friedrich der IV. versprach bei Räumung der Barrikaden den Abzug der Truppen und die Erfüllung der Forderungen der Revolutionäre. Unter dem Druck von Adel und Militär stellte er jedoch die alte Ordnung wieder her, seine Truppen kehrten nach Berlin zurück.
Friedrich Hecker, Jurist und Politiker im Großherzogtum Baden, wollte Demokratie und Freiheit auch in seiner Heimat durchsetzen. Am 12. April 1848 rief er gemeinsam mit Struve und Sigel (Alle drei gingen später ins Exil und spielten beim Sezessionskrieg in den USA eine wichtige Rolle.) in Konstanz zu einem Revolutionszug auf. Mit einem bunt zusammengewürfelten und schlecht bewaffneten Haufen zog er über Stockach nach Rastatt. Die Aufständischen wurden südlich von Rastatt durch badische Truppen vernichtend geschlagen.
Der „Bundestag“ des Deutschen Bundes beschloss - ein unter den damaligen Zuständen sensationelles Gesetz - das sog. Bundes-Wahlgesetz, eines der wichtigsten Vorbedingungen für die Bildung der Nationalversammlung. Je 50.000 Einwohner konnten einen Abgeordneten (Delegierten) wählen. Wahlberechtigt waren männliche, volljährige und selbstständige Staatsangehörige. Frauen waren noch lange Zeit ausgeschlossen. Die Wahl erfolgte im April 1848. Die 600 Delegierten der Nationalversammlung - als erste gesamtdeutsche Volksvertretung - tagten zum ersten Mal am 18. Mai 1848 in der Paulskirche in Frankfurt, um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaates zu beraten. Sie repräsentierten maßgebliche politische Strömungen nahezu jeder Couleur. Die monarchistische Rechte setzte sich für die Wahrung der Vorrechte der Einzelstaaten und der Monarchen ein. Die verschiedenen liberalen Gruppierungen des sog. Rechten und Linken Zentrums befürworteten eine föderal strukturierte, konstitutionelle Monarchie. Einige Historiker bemängelten jedoch eine Unterrepräsentation der unteren Bevölkerungsschichten und des bürgerlichen Mittelstandes: Das Parlament sei ein Beamten-, Universitäts- und Juristen-Parlament (80 Prozent Akademiker) und kein getreues Abbild der sozialen Verteilung gewesen. Dennoch urteilten namhafte Historiker später: Die Nationalversammlung und andere Versammlungen dieser Zeit zeigten viele Ansätze eines entwickelten Parlamentarismus [...]. Das Bürgertum war im Umgang mit politischer Macht in demokratischen Institutionen erstaunlich reif und fähig zum parlamentarischen Kompromiss. Neben dem Hambacher Schloss sollte auch die Paulskirche späteren Generationen als Symbol der demokratischen Bewegung in Deutschland gelten.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе