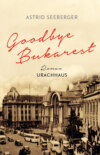Читать книгу: «Nächstes Jahr in Berlin», страница 3
Auf der Insel, den 1. Januar 2013
Silvester verlebten wir in aller Stille. Wir waren daheim auf der Insel, nur Lech und ich. Es war dunkel, die Dunkelheit hielt alles umschlungen. Wir standen am Fenster, als das neue Jahr anbrach. Das Eis leuchtete weiß. Trotz des Tauwetters türmte sich der Schnee noch immer hoch. Es sah aus, als würde der Himmel im Süden eine Spur heller werden. Vielleicht lag es an den Raketen über Nyköping.
Ich schaute Lech an. Sein Gesicht war vollkommen nackt, ohne jeden Schutz. Er legte seinen Arm um mich. Eine Zeit lang atmeten wir Mund an Mund.
Dann hörten wir uns Musik an, Isabelle Faust und Alexander Melnikov, die Beethovens Sonaten für Klavier und Violine spielten. Die Geige klang einzigartig, besser noch als das Klavier. Sie hat einen Namen, sagte Lech: Dornröschen.
Dornröschen, eins von Stradivaris Glanzstücken, war fast hundertfünfzig Jahre verschollen gewesen. Als sie wiedergefunden wurde, hatte die Landesbank Baden-Württemberg sie gekauft. Und dort lag sie dann im Tresor, man konnte sie ausleihen, das aber war ungemein teuer.
Als sich Isabelle Faust in Stuttgart aufhielt, konnte sie nicht anders, als Dornröschen auszuprobieren. Das Instrument war verschlossen und stumm, bloß ein Stück Holz ohne Leben. Es weigerte sich zu klingen, nachdem es so viele Jahre unberührt dagelegen hatte. Isabelle Faust aber gab nicht auf. Der Bogen streichelte und strich. Und dann plötzlich … Ein paar Töne lugten hervor, mitten aus all der Verschlossenheit … Wie wenn man vor einem alten Altarbild steht, das die Kerzen der Betenden mit Ruß bedeckt haben, und hier und da und nur bei einem gewissen Licht die ursprünglichen Farben aufleuchten sieht. Die Geigerin hatte eine Stimme vernommen. Eine Stimme, die sie wiedererkannte, als wäre es ihre eigene. Ein halbes Jahr später hatte sie einen Sponsor gefunden. Hatte Dornröschen geholt und ihr Leben mit ihr begonnen.
Es dauert lange, bevor eine Geige, die fast hundertfünfzig Jahre einsam war, bereit ist, sich auf jemanden einzulassen. In Dornröschens Fall sechs Jahre, in denen der Bogen immer aufs Neue über die Saiten strich, bevor Töne erklangen, von Mal zu Mal wärmer und strahlender. Bis sich die Geige gänzlich geöffnet hatte. Und mit einer Leuchtkraft sang, die ohnegleichen war. Wie beim Liebesspiel, sagte Lech.
Stuttgart, den 26. November 2007
Nachdem ich mit Lech über Dresden geredet hatte, saß ich auf der Bettkante. Regen setzte ein, ein heftiger Platzregen. Man konnte den Eindruck bekommen, die Stadt versinke. Tief unten waren nur dunkle Nebel zu erahnen, ein paar glänzende Lichter darin als letzte Zeichen von Leben. Als wäre ein Damm gebrochen und die Stadt vom Wasser geschluckt worden.
Ich schaltete die Nachttischlampe ein. Mutters Handtasche stand auf dem Boden. Ich hatte nur die Schlüssel herausgenommen, als ich in ihre Wohnung fahren wollte. War nicht fähig gewesen, sie durchzugehen, als wäre sie ein Teil von Mutters Körper. Ich nahm sie hoch und fuhr mit der Hand über das braune Leder. Es war weich, Mutter hatte gesagt, sie sei aus Kalbsleder.
In der Tasche lagen ein schwarzes Portemonnaie, ein roter Knirps, eine halb leere Packung Papiertaschentücher und ein dunkelroter Taschenkamm, auf dem in goldenen Buchstaben Hercules Sägemann stand.
Im Portemonnaie steckten siebzig Euro in Scheinen und ein paar kleinere Münzen sowie die Quittung einer chemischen Reinigung. Und Mutters Personalausweis mit einem Foto, auf dem sie tapfer den Mund verzog, als ließe sich ihr Flüchtlingsgesicht durch ein Lächeln verändern. Und ein Foto von Vater in einer Plastikhülle, in der auch sein Schwerbehindertenausweis steckte, sein Gesicht darauf war seltsam verschwommen. Und daneben ein weiteres Foto, vergilbt mit gezackten weißen Rändern, auf dem Mutter als Halbwüchsige stand, zwischen ihren älteren Brüdern Ewald und Bruno. Doch gab es kein Bild von mir.
Leichte Übelkeit überkam mich. Mir fiel ein, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Ich schloss die Tasche und stand auf. Es war Zeit, sich umzuziehen. Das schwarze Kleid, das ich im Bestattungsinstitut getragen hatte, konnte mir gestohlen bleiben. Ich entschied mich für das grüne Seidenkleid, das ich in München gekauft hatte, als die wirbelnden Herbstblätter den Ort in eine raschelnde Stadt verwandelt hatten. Als Lech und ich mitten durch das Gewirbel geschlendert waren. Dieses Kleid hatte ich eingepackt, als könnten Kleider Kraft spenden.
Ich ging ins Bad und schminkte mich. Dann verließ ich das Zimmer, die Schatten des Gesichts unterm Make-up verborgen, hoch aufgerichtet, mit leuchtend rotem Mund und trommelnden Stöckelschuhen.
Im Restaurant saßen nur wenige Gäste. Ein Paar mittleren Alters, das schweigend, als wäre zwischen ihnen bereits alles gesagt, seine Mahlzeit einnahm, und hier und da ein Geschäftsreisender. Ich setzte mich an einen Tisch weit weg, neben eine dunkle Wand, an der Wasser hinabrann wie in meiner Kindheit an den Schaufenstern der Fischläden.
Auf dem Tisch stand eine Vase mit einer weißen Rose. Ich hätte eine Nelke oder Tulpe vorgezogen. Ein Kellner tauchte auf, ein junger, schmächtiger Mann, der mich willkommen hieß, als hätte er auf mich gewartet. Er beugte sich über den Tisch und zündete voller Andacht eine Kerze an, die neben der Vase mit der Rose stand. Ich sagte: »Genauso zündet man in der Kirche eine Kerze für die Toten an.«
Er erstarrte, das brennende Streichholz in der Hand. Dann sagte er, nachdem er die Flamme im letzten Moment gelöscht hatte: »Der Regen kann einen ganz melancholisch machen, nicht wahr, Madame? Man kann etwas Trost brauchen. Warum nicht durch ein gutes Essen?« Und er legte mir die Speisekarte wie eine Art Rettungsring hin. Dann verschwand er ebenso geräuschlos, wie er gekommen war.

Zu ihrem achtzigsten Geburtstag hatte Mutter ein Geschenk von mir bekommen, eine wunderschöne Ausgabe von Gertrude Steins Buch Die Welt ist rund über ein Mädchen, das denselben Namen trug wie Mutter: Rose.
Im Buch steigt Rose auf einen Berg. Und gelangt auf dem Weg zu einem Baum, in dessen Rinde sie ihren Namen ritzt: Rose ist eine Rose ist eine Rose … Denn so gibt es nichts mehr, nirgendwo, das ihr in der Nacht Angst machen kann. Und als Rose mit dem Einritzen fertig ist, singt sie. Denn sie hat etwas auf dem Baum nebenan bemerkt. Jemand hat ihren Namen dort eingeritzt. Und dazu einen weiteren Namen, Willie, der ihr Mann werden wird. Und einen dritten Namen, Billie. Billie war der Löwe im Buch, der Löwe, der verschwand.
Als ich am Morgen nach Mutters Geburtstag aufwachte, hörte ich Scheppern und Klirren. Mutter rumorte in der Küche. Schubladen wurden krachend zugeschoben. Teller klapperten. Etwas fiel polternd zu Boden. Ich unterließ es, darüber nachzudenken, ob sie den Lärm ihret- oder meinetwegen veranstaltete.
Ich nahm das Buch zur Hand, das ich mitgebracht hatte, Kafkas Erzählungen. Und las die letzte Geschichte, die Kafka geschrieben hat: Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse. Sie war entstanden, als er das erste Mal mit einer Frau zusammenlebte, mit Dora Diamant, gerade, als der Tod ihn in die Fänge bekommen hatte.
Ich las von Josefines Singen, besser gesagt von ihrem Pfeifen, mit dem sie das Mäusevolk zum Träumen brachte: »Etwas von der armen, kurzen Kindheit ist darin, etwas von verlorenem, nie wieder aufzufindendem Glück, aber auch etwas vom tätigen, heutigen Leben ist darin, von seiner kleinen, unbegreiflichen und dennoch bestehenden und nicht zu ertötenden Munterkeit.« Während Mutter weiter klapperte und rumorte.
Als ich die Erzählung zu Ende gelesen hatte, stand ich auf. Mutter war damit beschäftigt, mit der Brotmaschine ein paar Scheiben zum Frühstück abzuschneiden. Sie hielt mit einer Hand das Brot fest und drehte die Kurbel mit der anderen. Noch immer hatte sie ihr Nachthemd an, ein weißes, knöchellanges Baumwollhemd mit blauen Blümchen. Sie drehte die Kurbel wie wild, und ihre Unterlippe zitterte. Die Haut an ihren Oberarmen hing herunter, wie sie es tut, wenn Leute abmagern, ja flatterte geradezu. Ich fand, dass Mutter noch nie so hilflos ausgesehen hatte.
Ich sagte Guten Morgen, etwas anderes fiel mir nicht ein. Sie habe die ganze Nacht nicht geschlafen, sagte Mutter. Sie habe das Buch gelesen, das ich ihr gegeben habe. Es sei schrecklich gewesen. Und sie drehte die Kurbel immer weiter, als müsste sie irgendetwas wegkurbeln.
Schließlich setzten wir uns an den Frühstückstisch. Mutter goss Kaffee ein. Wir aßen schweigend. Mutter kaute, als müsste sie Steine zermalmen. Ihr kurz geschnittenes Haar war grau und glatt, ähnelte einem Helm aus Metall. Ihre Finger bewegten sich fahrig, ständig fiel ihr etwas aus der Hand. Am Ende sagte ich etwas, das wie von selbst kam: Muttilein. Ich sagte es so, wie ich es als Kind getan hatte. Ich weiß nicht, wie sie reagierte. Ich konnte sie nicht anschauen, nicht in diesem Moment. Es ging nicht anders, meine Augen waren kurz vorm Überlaufen.

Der Kellner kam zurück und fragte, ob ich mich entschieden hätte. Ich bestellte eine Schwarzwaldforelle, obgleich ich den Schwarzwald nicht mochte. Auch Mutter mochte ihn nicht, die Wälder dort waren zu dunkel und die Berge zu hoch. Auch als Vater sie zum Titisee schleppte, ließ sie das kalt. Schwarzwalds Perle, das sei ihr schnuppe, sagte sie, der See spiegele schließlich die Berge. Nicht wie in Ostpreußen, wo die Seen den Himmel spiegelten.
Mutter mochte auch keine Perlen. Sie seien wie Fischaugen, sagte sie, wenn man die Fische kochte. Bernstein hingegen liebte sie.
Als wir in Waldstadt wohnten, fuhren wir oft nach Gmünd, der zehn Kilometer entfernten Bezirkshauptstadt. Und immer gingen wir durchs Predigergässle, wo es ein Juweliergeschäft gab, das Bernsteinschmuck im Schaufenster liegen hatte. Obwohl nichts davon so unvergleichlich schön war wie jener Bernstein, den Mutter einmal besessen hatte. Sie hatte ihn am Frischen Haff gefunden, sagte sie, es war ein honiggelber Bernstein, der die Spitze eines Libellenflügels einschloss. Sie hatte ihn den ganzen Krieg über bei sich getragen, bis er wie alles andere verschwunden war.
Als Kind dachte ich manchmal an diese Libelle, wenn ich im Bett lag und Mutter das Licht ausgeschaltet hatte und gegangen war. Ich stellte mir vor, wie ein heftiger Windstoß sie packte und gegen einen Baum, gegen das herausquellende Harz schleuderte. Wie sie mit einem Flügel kleben blieb und mit dem anderen verzweifelt flatterte, bis sie, als die Dunkelheit hereinbrach, still dasaß, vollkommen still, und nur die dünnen Beine noch ab und zu zitterten.

Ein Mann kam und fragte, ob er an meinem Tisch Platz nehmen dürfe. In seinem Blick funkelte etwas. Das erlosch, als ich Nein sagte und dass ich allein bleiben wolle, ich hätte soeben meine Mutter im Kühlraum gesehen, starr und tot. Ich habe ihm meine tote Mutter an den Kopf geworfen. Er sagte Entschuldigung und setzte sich an einen Tisch am anderen Ende des Saals.
Ich wollte aufspringen, wollte nach draußen laufen, weg aus dem Restaurant, in dem Männer Angelhaken in den Augen hatten, weg aus dem Hotelzimmer, dessen Aussicht einem das Herz abschnürte, weg von Mutter, die zusammengeschrumpft in einem Kühlraum lag. Sollten sie die Forelle doch in den Abfalleimer werfen. Dennoch blieb ich sitzen und starrte in die Kerzenflamme, auch sie erzitterte zuweilen.
Mit lautlosen Schritten kam der Kellner zurück und stellte Wein, Wasser und Brot auf den Tisch, wie Köstlichkeiten. Vielleicht sah er das so, oder er hatte diese Gesten bei der Gastronomieausbildung gelernt. Als er sich vorbeugte, fiel ein dunkler Schatten auf seine Wange.
Ich fragte ihn, wo er aufgewachsen sei.
In Frankfurt, sagte er, mitten in der Stadt.
Sehne er sich dahin zurück?
Manchmal, sagte er. Dort war mehr los. Ich sagte nicht, dass es für mich nichts Schlimmeres gab als dieses Mehrlossein. Heftige Sehnsucht nach Lech packte mich, ich wünschte mir, in seinen Armen zu liegen.

Ich musste an den Tischler aus Waldstadt denken, der plötzlich verschwunden war. Vater hatte mir nach seinem ersten Schlaganfall von ihm erzählt. Es war, als hätte dieser Schlaganfall eine Sperre geöffnet, Vater sprach über alles, auch über Dinge, über die man mit seinem Kind nicht spricht.
Eines Morgens, sagte Vater, als die Frau des Tischlers wach wurde, war der Tischler verschwunden. Auf seinem Kopfkissen lag ein Brief, in dem er ihr mitteilte, er sei gezwungen zu gehen. Er müsse nach Jerusalem pilgern. Und neben dem Brief lag ein Penis aus Holz, der genauso war wie sein eigenes Glied, wenn ihn die Lust nach ihrem Körper überkam. Mit allen Blutgefäßen an der Oberfläche und mit einer Eichel, die der Tischler poliert hatte, sodass sie wie seine eigene glänzte. Wenn es zu schwer werde, ihn zu entbehren, schrieb er, eine Pilgerreise nach Jerusalem könne Jahre dauern.
Er kam zu ihr zurück, kurz bevor wir aus Waldstadt fortzogen, nach zehn Jahren Wanderschaft. Falls er das wirklich war. Der Tischler hatte dickes dunkles Haar gehabt, der zurückkam, war glatzköpfig. Und der Glatzköpfige hatte ein anderes Gesicht, zerfurcht und nahezu schwarz. Und eine heisere Stimme, nicht die klare, die der Tischler gehabt hatte. Doch als er sein Glied hervorholte … und die Frau des Tischlers es in die Hand nahm und die Augen schloss, sagte sie, doch ja, sie erkenne alles wieder, besonders das Pochen.
Später, als sie zusammen im Bett waren, erzählte sie, die Leute hätten ihr in den Ohren gelegen, sie solle ihn für tot erklären lassen. Das aber habe sie nicht fertiggebracht. Nicht, wo er doch Nacht für Nacht in ihren Schoß eingedrungen war. »Ich weiß«, hatte er gesagt, »sogar als ich auf dem Ölberg stand.«
»Ungefähr so haben sie gesprochen«, sagte Vater, was auch immer er darüber wissen konnte. Er saß auf der blauen Nappaledercouch mit einem Kissen im Rücken, es war keins der bestickten, sondern ein flaches, bezogen mit rotem Frotteestoff, einem Kissenschutz, wie Mutter sagte. Denn Vater hatte einen Buckel, der überall Löcher hineinrieb.

Der Kellner kam zurück mit einem riesigen weißen Teller, auf dem die Forelle lag. Sie sah verloren aus, obgleich sie auf einem Bett aus Mangold ruhte, daneben ein Häufchen glänzenden Kartoffelpürees. Und obgleich der Koch auf die leere Porzellanfläche aufmunternde Schnörkel mit einer blassroten Soße gemalt hatte. Vielleicht lag es an der Farbe der Fischhaut. Sie hatte einen Glanz, der sich nicht entschließen konnte, ob er blau oder schwarz sein wollte.
Ich begann zu essen. Das Fischfleisch war saftig und zart. Es war leicht, sich einen klaren Bach vorzustellen, in dem die Forelle zuweilen einen Sprung tat, aus Lust am Leben oder aus Neugier, um zu sehen, was es oberhalb der Wasserfläche gab, um einen kurzen Blick auf ein anderes Leben zu werfen.
Wie lange hatte Mutter auf ein anderes Leben gewartet? Vielleicht hatte sie aufgegeben, als Vater starb. Als alle verschwunden waren. Auch ich. Als das Einzige, was es noch gab, Leere war.

Ich wuchs mit Mutters Sehnen auf. Vielleicht war dieses Sehnen der Grund, weshalb Vater ein Radio gekauft hatte, einen schwarzen Apparat von Grundig. Beständig saß ich auf einem Hocker davor und lauschte. Durch die Glasscheibe vorn, auf der Zahlen und merkwürdige Namen standen – Paris, London, Beromünster –, wurde man eine Welt gewahr, getaucht ins gelbrote Licht der glimmenden Röhren. Und Menschen, die unsichtbar blieben, während sie in allen Sprachen der Welt redeten, sangen und Musik machten, einmal sogar Waldhorn spielten.
Und einen gab es dort Tag für Tag, pflichtgetreu, einen Mann, der endlose Namenslisten vorlas, es ging um Menschen, die im Krieg verloren gegangen waren. Wenn man ihn vernahm, konnte man meinen, im Land des Vermissens zu wohnen. Wenn Mutter zuhörte, strickte sie Pullover und Strümpfe, als könnte Stricken gegen das Sehnen helfen. Sie vermisste so viele, ihren Vater, der einem König geglichen hatte, und ihre Mutter, deren Haar den Himmel gespiegelt hatte, und ihre Geschwister, hauptsächlich Bruno und Ewald, und ein bisschen auch Luzie, am allerwenigsten noch die jüngsten Brüder Hubert und Alfred.
Manchmal nannte der Namensvorleser ein besonderes Kennzeichen, das ein Verschwundener gehabt hatte, zum Beispiel eine glänzende runde Narbe außen am linken Handgelenk. Es war ein Mädchen in meinem Alter, das diese Narbe gehabt hatte, eine ebensolche Narbe, wie ich sie hatte. Ich erinnere mich, dass ich Mutter angesehen habe, sie mich aber nicht. Sie strickte nur immer hektisch weiter, auf das Strickzeug starrend, während die Nadeln klapperten. Seitdem klingt das Wort Sehnen für mich nach Klappern.

Ich war mit dem Essen fertig. Auf dem Teller lag noch das Fischskelett. Ich musste an ein Buch denken, das Lech in einem Berliner Antiquariat gefunden hatte, mit Bildern von Tiefseefischen. Er hatte mir einen Blindfisch gezeigt, der mit seinen Flossen unablässig den Meeresboden berührt, um nicht verloren zu gehen. Und einen Laternenfisch, der in der ewigen Finsternis aufzuleuchten vermag und so seinen Weg findet. Sie vermissen das Licht nicht, hatte Lech gesagt, man vermisst nur Dinge, von denen man weiß, dass es sie gibt.
Der Kellner kam und fragte, ob er zu einem Dessert verführen könne, während er den Teller fortzauberte. Ich erwiderte, ich sei satt, und bat um die Rechnung. Er hörte, leicht vorgebeugt, zu, als wollte er kein Wort verpassen, und reagierte mit einer leichten Verbeugung: »Wie Sie wünschen, Madame!«
Ich hatte Lust zu schreien, dass ich alles in dieser Stadt satthätte. Die Stadt, die Vater verschlungen hatte. Die versucht hatte, mich zu verschlingen. Wer Mutter verschlungen hatte, war ich mir nicht sicher, nicht, nachdem ich sie im Kühlraum gesehen hatte.
Als ich wieder im Hotelzimmer war, rief ich Lech an. Ich sagte, es fühle sich an, als läge Stockholm auf einem anderen Planeten. Er erwiderte, er würde seine Arme ausstrecken, und die reichten bis zu mir hinunter. Ja, erwiderte ich. Als wir das Gespräch beendet hatten, blieb ich auf der Bettkante sitzen. Es gibt Augenblicke, in denen weiß man weder aus noch ein.
Auf der Insel, den 13. Januar 2013
Die Kälte ist zurückgekehrt. Und es hat erneut geschneit. Taubengraue Wolken hängen am Himmel. Vor einer Weile ist Jan gegangen. Er wohnt auf dem Festland, in einem großen ockerfarbenen Haus. Vor fünf Jahren hatte man ihm eine Lunge entfernt. Der Krebs hatte seine Klauen in ihn geschlagen. Nachdem so viele Jahre vergangen waren, glaubte er, dem Krebs entronnen zu sein. Der aber hatte wieder zugeschlagen. Vorgestern musste er sich von Neuem einer Chemotherapie unterziehen.
Als er heimgekommen war, so erzählte er, hatte er sich, ohne sein Gewehr, zu einem Hochsitz aufgemacht, der etwa einen Kilometer von seinem Haus entfernt steht. Er war hinaufgestiegen und hatte dort in der Dämmerung gesessen. Die Felder leuchteten weiß in der zunehmenden Dunkelheit. Ein Rudel Damhirsche zog langsam vorbei, ein Tier nach dem anderen wie bei einer Prozession. Er hatte ihre dünnen, abgemagerten Körper ganz aus der Nähe gesehen. Als sie im Wald verschwunden waren, hatte er noch immer nicht gehen können. Erst als es schon Nacht war, stieg er hinunter, vollkommen durchgefroren, doch das spielte keine Rolle.
Als Jan gegangen war, setzte ich mich an den Schreibtisch. Ich kann nicht anders. Hat man erst einmal erlebt, wie es ist, wenn man beim Schreiben etwas zu fassen bekommt, das einem lebenswichtig erscheint, muss man es immer wieder erleben. Es ist wie eine Offenbarung.
Und ich musste an die Gans denken, von der Sebald in seinem Roman Austerlitz schrieb. Als Austerlitz zusammen mit der Frau, mit der er hätte glücklich werden können, wäre er nicht verloren gewesen, einen Zirkus besucht und von dem künstlichen Firmament ergriffen ist, das sich in der Dunkelheit über ihm offenbart. Dann sieht er die Zirkusartisten hereinkommen, den »Zauberkünstler und seine sehr schöne Frau und ihre drei schwarzgelockten, nicht weniger schönen Kinder, das letzte von ihnen mit einer Laterne und in Begleitung einer schneeweißen Gans«. Und er fühlt etwas, von dem er nicht weiß, ob es Schmerz oder Glück ist, als die Artisten eine seltsame Musik erklingen lassen, Melodien, die er seit Langem vergessen hat. Es war, sagt Austerlitz später, als ob das Geheimnis aufgehoben gewesen sei in dem Bild der Gans, die, während sie spielten, vollkommen reglos dastand. »Mit etwas vorgerecktem Hals und gesenkten Lidern horchte sie in den von dem gemalten Himmelszelt überspannten Raum hinein, bis die letzten Töne verschwebt waren, als kennte sie ihr eigenes Los und auch das derjenigen, in deren Gesellschaft sie sich befand.«
Einmal war Vater mit einem Sack heimgekommen, in dem eine lebendige Gans steckte. Er hatte sein Waldhorn auf einer Bauernhochzeit ertönen lassen und zur Bezahlung die Gans erhalten. Mutter sagte, er solle sie schlachten. Er ging mit dem Sack und der Axt zum Hackklotz, der sich in einer Ecke des Hofes befand. Als er zurückkam, glänzte die Axt genauso sauber wie zuvor, und der Sack bewegte sich. Also trabte Mutter los, wild entschlossen. Als sie vom Hof hereinkam, baumelte der Gänsekörper von ihrer Hand.
Ich erinnere mich, dass ich dabei war, als sie die Innereien entfernte. Ich hielt das Gänseherz, das noch immer warm war, in der Hand.
Бесплатный фрагмент закончился.