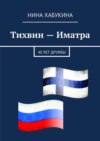Читать книгу: «Zwangsvollstreckungsrecht, eBook», страница 2
IV. Andere Behörden als Vollstreckungsorgane 8.38, 8.39
1. Grundbuchamt 8.38
2. Einschreiten anderer Behörden 8.39
§ 9 Beginn, Stillstand und Beendigung der Zwangsvollstreckung
I. Beginn der Zwangsvollstreckung 9.2
II. Stillstand der Zwangsvollstreckung 9.3 – 9.12
1. Einstellung der Zwangsvollstreckung und ihre Anordnung 9.4 – 9.10
a) Einstellung auf Anordnung des Gerichts 9.6
b) Einstellung ohne gerichtliche Anordnung 9.7 – 9.9
c) Fortgang nach Einstellung 9.10
2. Tatsächlicher Stillstand 9.11
3. Prüfung der Einstellungsvoraussetzungen 9.12
III. Beendigung der Zwangsvollstreckung 9.13 – 9.15
1. Beendigung im Ganzen 9.14
2. Beendigung einzelner Vollstreckungsmaßnahmen 9.15
IV. Aufhebung einzelner Vollstreckungsmaßnahmen 9.16 – 9.19
1. Aufhebungsgründe 9.17
2. Aufhebung durch das Vollstreckungsorgan 9.18
3. Durchführung der Aufhebung 9.19
§ 10 Vollstreckungsverträge
I. Das Vollstreckungsrecht als grundsätzlich zwingendes Recht 10.1, 10.2
II. Einzelne Zulässigkeitsfragen 10.3 – 10.12
1. Vollstreckungserweiternde Verträge 10.4, 10.5
2. Vollstreckungsausschließende Verträge 10.6 – 10.9
a) Materiellrechtliche Vereinbarungen 10.7
b) Regelung von Vollstreckungsmodalitäten 10.8
c) Vollständiger Vollstreckungsausschluss 10.9
3. Gegenständliche Beschränkung der Vollstreckung 10.10 – 10.12
a) Vereinbarung vor Beendigung des Rechtsstreits 10.11
b) Vereinbarung nach Beendigung des Rechtsstreits 10.12
§ 11 Mängel des Zwangsvollstreckungsverfahrens
I. Gesetzmäßigkeitsgrundsatz und fehlerhafter Staatsakt 11.1
II. Anfechtbarkeit als Regelfolge – Verstrickung 11.2, 11.3
III. Verstrickung und Pfändungspfandrecht 11.4 – 11.7
1. Nichtiger Vollstreckungsakt und Pfändungspfandrecht 11.5
2. Anfechtbarer Vollstreckungsakt und Pfändungspfandrecht 11.6
3. Privatrechtliche Voraussetzungen des Pfändungspfandrechtes 11.7
IV. Die Heilung fehlerhafter Vollstreckungsakte 11.8
Drittes Kapitel Die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
§ 12 Mängel des Zwangsvollstreckungsverfahrens
I. Vollstreckungsvoraussetzungen und Formalisierung der Vollstreckung 12.1
II. Titel und Klausel als Vollstreckungsvoraussetzungen 12.2
III. Voraussetzungen des Beginns der Vollstreckung und Vollstreckungshindernisse 12.3 – 12.5
1. Voraussetzungen des Vollstreckungsbeginns 12.3
2. Vollstreckungshindernisse 12.4, 12.5
IV. Personenmehrheiten 12.6
V. Allgemeine Voraussetzungen des Verfahrensrechts 12.7 – 12.15
1. Deutsche Gerichtsbarkeit 12.8
2. Funktionelle und örtliche Zuständigkeit 12.9
3. Rechtswegzuständigkeit 12.10
4. Partei- und Prozessfähigkeit 12.11
5. Prozessvollmacht 12.12
6. Prozessführungsbefugnis 12.13
7. Rechtsschutzinteresse 12.14
8. Rechtskraft 12.15
§ 13 Der Vollstreckungstitel im Allgemeinen
I. Begriff und Wesen des Vollstreckungstitels 13.1
II. Bestimmung der Parteien der Vollstreckung im Titel 13.2
III. Bestimmung von Inhalt und Umfang der Vollstreckung durch den Titel 13.3, 13.4
IV. Verlust des Titels 13.5
V. Mehrheit von Titeln 13.6
VI. Vollstreckbarkeit im engeren und im weiteren Sinne 13.7
§ 14 Die Endurteile
I. Begriff des Endurteils 14.1 – 14.5
1. Endurteile ordentlicher Gerichte 14.2
2. Vollstreckungsfähige Leistungsurteile – Bestimmtheit der Leistung 14.3, 14.4
3. Rechtskräftige und vorläufig vollstreckbare Endurteile 14.5
II. Rechtskräftige Endurteile als Vollstreckungstitel 14.6 – 14.11
1. Rechtsmittelfähige Urteile 14.7
2. Rechtsmittelverzicht 14.8
3. Teilanfechtung 14.9
4. Bedingte Urteile 14.10
5. Künftige Leistungen 14.11
III. Vorläufige Maßnahmen zur Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung (§ 707) 14.12 – 14.28
1. Voraussetzungen 14.13 – 14.17
a) Antrag 14.14
b) Keine Beendigung der Vollstreckung 14.15
c) Einlegung des Rechtsbehelfs 14.16
d) Möglicher Erfolg des Rechtsbehelfs 14.17
2. Inhalt der Maßnahmen 14.18 – 14.23
a) Einstweilige Einstellung 14.19, 14.20
b) Sicherheitsleistung des Gläubigers 14.21
c) Aufhebung der Vollstreckungsmaßnahme 14.22
d) Höhe und Art der Sicherheitsleistung 14.23
3. Zuständigkeit und Form der Entscheidung 14.24
4. Vorläufigkeit der Anordnungen 14.25
5. Abänderung und Aufhebung der Maßnahmen 14.26
6. Entsprechende Anwendung des § 707 14.27, 14.28
a) Kraft Gesetzes 14.27
b) Ohne gesetzliche Anordnung 14.28
§ 15 Die vorläufig vollstreckbaren Urteile
I. Grundsätze vorläufiger Vollstreckbarkeit 15.1 – 15.8
1. Grundsatz der Sicherheitsleistung 15.2
2. Vorläufig vollstreckbare Titel 15.3 – 15.7
a) Urteile 15.4
b) Sonstige Vollstreckungstitel (§ 794) 15.5
c) Ehe- und Kindschaftssachen 15.6
d) Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckbarkeit im weiteren und engeren Sinne 15.7
3. Anordnung von Amts wegen 15.8
II. Die Sicherheitsleistung im Einzelnen 15.9 – 15.31
1. Vorläufige Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung 15.10 – 15.20
a) Besondere Schutzbedürftigkeit des Gläubigers 15.11
b) Eilverfahren 15.12 – 15.15
aa) Versäumnisurteil 15.13
bb) Einspruch 15.14
cc) Neue mündliche Verhandlung 15.15
c) Urteile über geringe Summen 15.16 – 15.18
aa) Verurteilung in der Hauptsache bis 1250,– € 15.17
bb) Kostenerstattungsanspruch 15.18
d) Urteile mit erhöhter Richtigkeitsgewähr 15.19
e) Arreste und einstweilige Verfügungen 15.20
2. Vorläufige Vollstreckung und Sicherheitsleistung des Gläubigers 15.21 – 15.24
a) Bankbürgschaft 15.22
b) Sicherungsvollstreckung 15.23
c) Rückgabe der Sicherheit 15.24
3. Anträge des Gläubigers auf Erlass der Sicherheitsleistung und Schuldnerschutz 15.25 – 15.30
a) Gläubigerantrag auf Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung 15.26
b) Vollstreckungsschutz des Schuldners 15.27 – 15.30
aa) Abwendungsbefugnis 15.28
bb) Besonderer Vollstreckungsschutz 15.29
cc) Nicht zulässiges Rechtsmittel 15.30
4. Tenorierungsbeispiele 15.31
III. Entscheidungen über vorläufige Vollstreckbarkeit nach Rechtsbehelfen bzw. Rechtsmitteln 15.32 – 15.37
1. Vollstreckbarerklärung bei Teilanfechtung 15.33
2. Vorläufige Maßnahmen nach Einspruch, Berufung, Gehörsrüge und Revision 15.34 – 15.37
a) Einspruch und Berufung – Gehörsrüge 15.35
b) Revision 15.36, 15.37
IV. Vollstreckung aus vorläufigen Titeln 15.38 – 15.41
1. Wirkungen und Beschränkungen der Vollstreckung 15.39
2. Beendigung der vorläufigen Vollstreckbarkeit 15.40, 15.41
V. Schadensersatz bei ungerechtfertigter Vollstreckung 15.42 – 15.64
1. Voraussetzungen der Ersatzpflicht 15.43 – 15.46
a) Aufhebung oder Abänderung der Hauptsacheentscheidung in der Rechtsmittelinstanz 15.44
b) Schaden als Vollstreckungsfolge 15.45
c) Kein Verschulden 15.46
2. Inhalt und Umfang der Ersatzansprüche 15.47 – 15.50
a) Inhalt der Schadensersatzpflicht 15.48
b) Inhalt des Bereicherungsanspruchs 15.49
c) Nebeneinander von Schadensersatz und Bereicherung 15.50
3. Anspruchsinhaber und Anspruchsschuldner 15.51 – 15.53
a) Vertauschte Parteirollen 15.52
b) Rechtsnachfolge 15.53
4. Einwendungen 15.54 – 15.56
a) Mitwirkendes Verschulden 15.55
b) Aufrechnung 15.56
5. Geltendmachung des Anspruchs 15.57 – 15.59
a) Selbstständige Klage 15.58
b) Rechtsverfolgung im anhängigen Rechtsstreit 15.59
6. Rechtsnatur des Anspruchs 15.60
7. Entsprechende Anwendung des § 717 15.61 – 15.64
a) Gesetzliche Fälle 15.62
b) Fälle der Analogie 15.63
c) Ablehnung einer Analogie 15.64
§ 16 Sonstige Vollstreckungstitel
I. Überblick 16.1
II. Gerichtliche Entscheidungen 16.2 – 16.9
1. Kostenfestsetzungsbeschlüsse 16.3
2. Beschwerdefähige Entscheidungen 16.4
3. Vollstreckungsbescheide 16.5
4. Anwaltsvergleiche und Schiedssprüche 16.6 – 16.8
a) Anwaltsvergleiche 16.7
b) Schiedssprüche 16.8
5. Entscheidungen im einstweiligen Verfahren und Unterhaltsbeschlüsse 16.9
III. Der Prozessvergleich 16.10 – 16.16
1. Der Vergleich in den einzelnen Verfahrensarten 16.11
2. Dritte im Vergleich 16.12
3. Vollstreckungswirkung des Vergleichs 16.13
4. Einwendungen gegen den Vergleich 16.14
5. Vollstreckungsklausel 16.15
6. Räumungsvergleich 16.16
IV. Vollstreckbare Urkunde 16.17 – 16.32
1. Voraussetzungen wirksamer Unterwerfung 16.18 – 16.24
a) Notarielle Beurkundung 16.19
b) Unterwerfungsfähigkeit, Bestimmtheit und Rechtsnatur des Anspruchs 16.20
c) Unterwerfungserklärung 16.21 – 16.24
aa) Rechtsnatur 16.22
bb) AGB-Recht 16.23
cc) Dingliche und persönliche Unterwerfung, Eigentümergrundschuld 16.24
2. Vollstreckbare notarielle Ausfertigung 16.25
3. Rechtsbehelfe des Schuldners 16.26 – 16.31
a) Vollstreckungsgegenklage 16.27
b) Erinnerung 16.28
c) Klauselerinnerung 16.29
d) Abänderungsklage 16.30, 16.31
4. Vollstreckungsunterwerfung des Duldungspflichtigen 16.32
V. Vollstreckungstitel außerhalb der ZPO 16.33
VI. Leistungsklage trotz sonstigen Vollstreckungstitels? 16.34
§ 17 Die Vollstreckungsklausel
I. Wesen und Bedeutung 17.1 – 17.3
1. Die Klausel als amtliche Vollstreckbarkeitsbescheinigung 17.1, 17.2
2. Aushändigung der vollstreckbaren Ausfertigung nach Erfüllung 17.3
II. Ausnahmsweise Vollstreckung ohne Klausel 17.4
III. Inhalt der Klausel – vollstreckbare Ausfertigung 17.5
IV. Titelübertragende Klausel 17.6 – 17.27
1. Rechtsnachfolge auf Gläubiger- oder Schuldnerseite 17.7 – 17.19
a) Rechtsnachfolger des Gläubigers 17.8, 17.9
b) Rechtsnachfolger des Schuldners 17.10 – 17.12
aa) Gesamtrechtsnachfolger 17.11
bb) Sonderrechtsnachfolger 17.12
c) Partei kraft Amtes 17.13 – 17.19
aa) Insolvenzverwalter 17.14
bb) Testamentsvollstrecker 17.15, 17.16
cc) Nachlassverwalter 17.17
dd) Zwangsverwalter 17.18
ee) Gesetzliche und gewillkürte Prozessstandschafter 17.19
2. Titelübertragung ohne eigentliche Rechtsnachfolge 17.20 – 17.25
a) Nacherbschaft 17.21
b) Vermögensübernahme und Erbschaftskauf 17.22
c) Fortführung eines Handelsgeschäfts 17.23
d) Nießbrauchbestellung 17.24
e) Bucheigentümer 17.25
3. Verfahren zur Feststellung der Voraussetzungen einer Titelübertragung 17.26, 17.27
V. Titelergänzende Klausel 17.28 – 17.38
1. Vollstreckungsbedingungen 17.29 – 17.31
a) Kassatorische Klausel 17.30
b) Befreiung vom Nachweis der Entstehung und Fälligkeit 17.31
2. Verfahren zur Feststellung des Bedingungseintritts 17.32
3. Voraussetzungen des Vollstreckungsbeginns außerhalb des Klauselerteilungsverfahrens 17.33 – 17.37
a) Sicherheitsleistung 17.34
b) Kalendarische Zeitbestimmung 17.35
c) Fristablauf seit Zustellung 17.36
d) Alternative Leistungspflicht 17.37
4. Zug um Zug vorzunehmende Gegenleistung 17.38
§ 18 Das Verfahren zur Erteilung der Vollstreckungsklausel
I. Zuständigkeit 18.1 – 18.3
1. Gerichtliche Entscheidungen und Prozessvergleiche 18.2
2. Gerichtliche und notarielle Urkunden 18.3
II. Erteilungsverfahren 18.4 – 18.6
1. Antragsverfahren 18.4
2. Prüfungskompetenz im Klauselerteilungsverfahren 18.5
3. Urkundsbeamter und Rechtspfleger 18.6
III. Rechtsbehelfe der Parteien 18.7 – 18.14
1. Rechtsbehelfe des Gläubigers bei Verweigerung der Klausel 18.8
2. Einwendungen des Schuldners gegen die Klauselerteilung (Erinnerung) 18.9 – 18.14
a) Zuständigkeit 18.10
b) Beschränkung auf Prüfung formeller Voraussetzungen der Klauselerteilung 18.11
c) Entscheidung und Rechtsmittel 18.12
d) Einstweilige Anordnungen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit 18.13
e) Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 18.14
IV. Besondere Rechtsbehelfe bei titelübertragender oder titelergänzender Klausel 18.15 – 18.26
1. Klage des Gläubigers auf Klauselerteilung 18.16 – 18.20
a) Zuständigkeit 18.17
b) Rechtsnatur der Klage 18.18
c) Mögliche Einwendungen 18.19
d) Wirkung der Entscheidung 18.20
2. Klage des Schuldners auf Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus der erteilten Klausel 18.21 – 18.26
a) Rechtsnatur der Klage 18.22
b) Zuständigkeit 18.23
c) Mögliche Einwendungen 18.24
d) Vorläufige Maßnahmen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit 18.25
e) Verhältnis zu § 732 18.26
V. Weitere vollstreckbare Ausfertigung 18.27
VI. Klauselerteilung und neue Bundesländer 18.28
§ 19 Die Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten und Lebenspartner
I. Überblick 19.1
II. Die Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten 19.2 – 19.9
1. Drittwiderspruchsklage des anderen Ehegatten 19.2
2. Eigentumsvermutung und Gewahrsamsfiktion 19.3 – 19.9
a) Bedeutung 19.4 – 19.7
b) Geltungsbereich 19.8
c) Verfassungsmäßigkeit der Regelung 19.9
III. Besonderheiten beim Güterstand der Zugewinngemeinschaft 19.10 – 19.14
1. Drittwiderspruchsklage auf Grund § 1368 BGB 19.10, 19.11
2. Vollstreckungsrechtliche Besonderheiten der Ausgleichsforderung 19.12 – 19.14
a) Die Ausgleichsforderung als Pfändungsobjekt 19.13
b) Vollstreckung im Falle des § 1383 BGB 19.14
IV. Besonderheiten beim Güterstand der Gütergemeinschaft 19.15 – 19.23
1. Vollstreckung in das Sonder- und Vorbehaltsgut 19.16
2. Vollstreckung in das Gesamtgut 19.17 – 19.22
a) Alleinverwaltung 19.18
b) Gesamtverwaltung 19.19
c) Erwerbsgeschäft des nicht oder nicht allein verwaltungsberechtigten Ehegatten 19.20
d) Beendete Gütergemeinschaft 19.21
e) Fortgesetzte Gütergemeinschaft 19.22
3. Vorgehensweise des Gerichtsvollziehers 19.23
V. Die Zwangsvollstreckung gegen Lebenspartner 19.24 – 19.27
1. Überblick 19.24
2. Eigentumsvermutung und Gewahrsamsfiktion 19.25
3. Besonderheiten beim Vermögensstand der Ausgleichsgemeinschaft 19.26
4. Besonderheiten beim Vermögensstand der Gütergemeinschaft? 19.27
§ 20 Die Zwangsvollstreckung in den Nachlass und andere besondere Vermögensmassen
I. Die Zwangsvollstreckung in den Nachlass 20.2 – 20.28
1. Allgemeine Grundsätze 20.3 – 20.18
a) Vollstreckungsbeginn vor Tod des Erblassers 20.4, 20.5
aa) Fortsetzung der Vollstreckung (§ 779 Abs.1) 20.4
bb) Bestellung eines besonderen Vertreters (§ 779 Abs. 2) 20.5
b) Vollstreckungsbeginn nach Tod des Erblassers 20.6 – 20.9
aa) Vor Erbschaftsannahme 20.7
bb) Nach Erbschaftsannahme 20.8, 20.9
c) Die Beschränkung der Erbenhaftung 20.10 – 20.17
aa) Geltendmachung durch Erben (§ 781) 20.10
bb) Einordnung der Klage gemäß § 785 ins Rechtsbehelfssystem 20.11, 20.12
cc) Vorbehalt beschränkter Erbenhaftung 20.13 – 20.15
(1) Verfahrensweise 20.14
(2) Anwendungsbereich 20.15
dd) Aufhebung früherer Vollstreckungsmaßnahmen bei Nachlassverwaltung oder -insolvenz 20.16, 20.17
(1) Bei Vollstreckungen ins Eigenvermögen 20.16
(2) Bei Vollstreckungen in den Nachlass 20.17
d) Zusammenfassung 20.18
2. Besonderheiten bei der Miterbengemeinschaft 20.19 – 20.22
a) Vor Nachlassauseinandersetzung 20.19 – 20.21
aa) Vollstreckung in den Nachlass (§ 747) 20.19
bb) Haftungsbeschränkung 20.20, 20.21
(1) Allgemeines 20.20
(2) Vorläufig beschränkte Haftung gemäß § 2059 Abs. 1 BGB 20.21
b) Nach Nachlassauseinandersetzung 20.22
3. Besonderheiten bei Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung und Nachlassinsolvenz 20.23 – 20.28
a) Testamentsvollstreckung am Gesamtnachlass und an einzelnen Gegenständen 20.23 – 20.25
aa) Verwaltung des gesamten Nachlasses 20.24
bb) Verwaltung einzelner Nachlassgegenstände 20.25
b) Nachlassverwaltung 20.26
c) Nachlassinsolvenz 20.27, 20.28
II. Die Zwangsvollstreckung in Gesamthandsvermögen 20.29 – 20.39
1. Gesellschaft bürgerlichen Rechts 20.30 – 20.33
a) Vollstreckung von Gesamthandsverbindlichkeiten 20.31
b) Gesamtschuldnerische Haftung einzelner Gesellschafter 20.32
c) Vollstreckung durch „persönliche“ Gläubiger 20.33
2. Offene Handelsgesellschaft 20.34 – 20.38
a) Gläubiger der OHG 20.35
b) Gesamtschuldnerische Haftung einzelner Gesellschafter 20.36
c) Vollstreckung durch „persönliche“ Gläubiger 20.37, 20.38
3. Nicht-rechtsfähiger Verein 20.39
§ 21 Die Voraussetzungen für den Beginn der Zwangsvollstreckung
I. Bestimmtheit der Parteien einer Vollstreckung 21.2
II. Zustellung bestimmter Urkunden 21.3 – 21.8
1. Zustellung des Vollstreckungstitels 21.4 – 21.7
a) Amtsbetrieb 21.5
b) Parteibetrieb 21.6
c) Besonderheiten 21.7
2. Ausnahmsweise Zustellung der Klausel 21.8
III. Bedingter oder befristeter Titel 21.9 – 21.19
1. Sicherheitsleistung 21.10, 21.11
2. Kalendarische Zeitbestimmung bzw. Befristung 21.12 – 21.14
a) Die Vorratspfändung 21.13
b) Die Dauer- bzw. Vorauspfändung 21.14
3. Abhängigkeit der Vollstreckung von einer Zug um Zug-Leistung des Gläubigers 21.15 – 21.19
a) Tatsächliches Angebot 21.15
b) Wörtliches Angebot 21.16
c) Beweis der Befriedigung oder des Annahmeverzugs des Schuldners durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden 21.17
d) Vollstreckung durch das Vollstreckungsgericht 21.18
e) Verurteilung „nach Empfang der Gegenleistung“ 21.19
IV. Folgen des Fehlens von Voraussetzungen für den Vollstreckungsbeginn 21.20
Viertes Kapitel Der Gegenstand der Zwangsvollstreckung
§ 22 Allgemeines
I. Vermögensvollstreckung und Personalvollstreckung 22.1
II. Das Vermögen des Schuldners 22.2 – 22.9
1. Das Schuldnervermögen 22.3
2. Verwertbare Vermögensgegenstände 22.4, 22.5
a) Vermögensbegriff 22.4
b) Spezialitätsgrundsatz 22.5
3. Das gegenwärtige Vermögen 22.6
4. Das gesamte Vermögen 22.7
5. Keine Reihenfolge der Zugriffsmöglichkeiten 22.8
6. Mehrere Vermögensträger 22.9
III. Materiellrechtliche Haftungsbeschränkungen und Haftungserweiterungen 22.10, 22.11
1. Materiellrechtliche Beschränkungen 22.10
2. Materiellrechtliche Erweiterungen 22.11
§ 23 Die unpfändbaren Sachen
I. Reichweite des Pfändungsverbots 23.2 – 23.5
1. Beschränkung auf Vollstreckung wegen Geldforderungen – Pfändung eigener Sachen 23.3, 23.4
2. Materiellrechtliche Wirkungen? 23.5
II. Unpfändbare Gegenstände im Einzelnen 23.6 – 23.12
1. Auswahlkriterien und Fallgruppen 23.6, 23.7
2. Maßgebender Beurteilungszeitpunkt 23.8
3. Amtswegige Prüfung und Rechtsbehelfe 23.9, 23.10
4. Austauschpfändung 23.11
5. Pfändungsschutz für Surrogate? 23.12
III. Sonderschutz für Gegenstände des gewöhnlichen Hausrats 23.13
§ 24 Die aus sozialpolitischen Gründen unpfändbaren Forderungen und der Gläubigerschutz gegen Lohnmanipulation
I. Grundsätze 24.2
II. Pfändungsbeschränkungen beim Arbeitseinkommen und Pfändungsschutzkonto 24.3 – 24.47
1. Der Kreis geschützter Forderungen 24.4 – 24.17
a) Arbeitseinkommen 24.5 – 24.11
aa) Begriff 24.5
bb) Dienst- und Versorgungsbezüge 24.6
cc) Arbeits- und Dienstlöhne 24.7
dd) Ruhegelder und ähnliche Bezüge 24.8
ee) Hinterbliebenenbezüge 24.9
ff) Sonstige Vergütungen für Dienstleistungen aller Art 24.10
gg) Karenzentschädigungen und Versicherungsrenten 24.11
b) Nicht wiederkehrende Dienstleistungsvergütung 24.12
c) Versorgungsrenten 24.13
d) Naturalbezüge 24.14
e) Schutz bei Barauszahlung oder Kontoüberweisung – Pfändungsschutzkonto 24.15
f) Schutz gegen öffentlich-rechtliche Vollstreckung 24.16
g) Unverzichtbarkeit des Schutzes 24.17
2. Volle Unpfändbarkeit 24.18
3. Bedingte Pfändbarkeit („Billigkeitspfändung“) 24.19, 24.20
4. Beschränkte Pfändbarkeit 24.21 – 24.30
a) Laufendes Arbeitseinkommen 24.22 – 24.24
aa) Unpfändbarer Grundbetrag 24.23
bb) Unpfändbarer Teil des Mehreinkommens 24.24
b) Nicht wiederkehrend zahlbare Vergütung 24.25
c) Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens 24.26 – 24.30
aa) Ausgangspunkt 24.27
bb) § 850e Nr. 2 24.28
cc) § 850e Nr. 3 24.29
dd) § 850e Nr. 2a 24.30
5. Einschränkungen des Pfändungsschutzes bei privilegierten Vollstreckungsforderungen 24.31 – 24.37
a) Der Kreis privilegierter Forderungen 24.32
b) Umfang des verbleibenden Pfändungsschutzes 24.33 – 24.35
aa) Notwendiger Unterhalt 24.34
bb) Andere unterhaltsberechtigte Angehörige 24.35
c) Vorrangige Befriedigung aus zusätzlich pfändbarem Betrag 24.36
d) Vorratspfändung 24.37
6. Verfahren zur Berücksichtigung des Pfändungsschutzes 24.38 – 24.42
a) Verfahrensgrundsätze 24.38
b) Die Folgen fehlerhafter Rechtsanwendung 24.39 – 24.42
aa) Kein Pfändungspfandrecht 24.40
bb) Rechtsbehelfe 24.41
cc) Einwendung des Drittschuldners im Einziehungsprozess 24.42
7. Modifikation des Pfändungsschutzes nach richterlichem Ermessen 24.43 – 24.46
a) Schuldnerantrag 24.44
b) Gläubigerantrag bei Forderungen aus unerlaubter Handlung 24.45
c) Gläubigerantrag nach § 850f Abs. 3 24.46
8. Anpassung des Pfändungsschutzes an geänderte tatsächliche Verhältnisse 24.47
III. Gläubigerschutz durch Erweiterung der Pfändbarkeit 24.48 – 24.52
1. Lohnverschleierung 24.49 – 24.51
a) Tatbestand 24.50
b) Pfändung des fingierten Anspruchs 24.51
2. Lohnschiebung 24.52
IV. Pfändungsbeschränkungen bei Sozialleistungsforderungen 24.53 – 24.65
1. Überblick über die gesetzliche Regelung 24.53
2. Der Kreis geschützter Forderungen 24.54
3. Besondere Pfändungsschutzregeln des Sozialrechts 24.55 – 24.61
a) Einmalige Geldleistungen 24.55
b) Laufende Geldleistungen 24.56 – 24.58
aa) Rechtslage vor der Novelle 1994 24.57
bb) Die Neuregelung durch das 2. SGBÄndG 24.58
c) Pfändung von Kindergeld 24.59, 24.60
d) Schutz ausgezahlten Bargeldes und Kontenschutz 24.61
4. Das Pfändungsverfahren und seine besonderen Probleme 24.62 – 24.65
a) Billigkeitsvortrag 24.62, 24.63
b) Blankettpfändung 24.64
c) Rechtsbehelfe 24.65
§ 25 Sonstige unpfändbare Forderungen und Rechte
I. Unpfändbarkeit bei nicht übertragbaren Forderungen und nicht veräußerlichen Rechten 25.1 – 25.10
1. Unübertragbare Forderungen 25.3 – 25.9
a) Unübertragbarkeit auf Grund materiellen Rechts 25.4
b) Unübertragbarkeit nach § 399, 1. Alt. BGB 25.5 – 25.7
c) Pfändbarkeit kraft Vereinbarung unübertragbarer Forderungen 25.8, 25.9
2. Unveräußerliche Rechte 25.10
II. Unpfändbarkeit übertragbarer Ansprüche 25.11 – 25.15
1. Der Pflichtteilsanspruch 25.12
2. Schutz vor Pfändung aus sozialen Gründen 25.13 – 25.15
a) §§ 851a, 851b 25.14
b) § 863 25.15
III. Gesamthandsgemeinschaften 25.16 – 25.21
IV. Folgen des Verstoßes gegen §§ 851, 852 25.22
§ 26 Gläubigeranfechtung
I. Grundgedanken 26.1 – 26.9
1. Ausgangslage 26.1, 26.2
2. Begriff und Abgrenzung 26.3 – 26.9
a) Anfechtungsrecht 26.4, 26.5
b) Rückgewähranspruch 26.6 – 26.9
II. Voraussetzungen 26.10 – 26.50
1. Allgemeine Voraussetzungen 26.12 – 26.20
a) Rechtshandlung 26.12 – 26.15
b) Gläubigerbenachteiligung 26.16, 26.17
c) Zurechnungszusammenhang 26.18 – 26.20
2. Anfechtungsgrund 26.21 – 26.35
a) Vorsatzanfechtung 26.22 – 26.29
aa) Rechtshandlung des Schuldners (§ 3 Abs. 1 S. 1) 26.23, 26.24
bb) Abschluss eines entgeltlichen Vertrages (§ 3 Abs. 1, 2) 26.25 – 26.27
cc) Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners 26.28
dd) Kenntnis des anderen Teils 26.29
b) Schenkungsanfechtung 26.30 – 26.34
aa) Unentgeltliche Leistung 26.31, 26.32
bb) Vornahme binnen Vierjahresfrist 26.33, 26.34
c) Weitere Anfechtungsgründe 26.35
3. Besondere Anfechtungsvoraussetzungen 26.36 – 26.44
a) Gläubigerseite 26.36 – 26.42
aa) Vollstreckbarer Schuldtitel 26.37 – 26.39
bb) Geldforderung 26.40
cc) Fälligkeit 26.41, 26.42
b) Schuldnerseite 26.43, 26.44
4. Einwände des Anfechtungsgegners 26.45 – 26.50
a) Einwände gegen Titel 26.46
b) Einwände gegen den Anspruch 26.47 – 26.49
c) Der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gegen das Anfechtungsrecht 26.50
III. Rechtsfolgen 26.51 – 26.88
1. Die Parteien des Rückgewährschuldverhältnisses 26.51 – 26.67
a) Anspruchsinhaber 26.52 – 26.60
aa) Mehrheit von Berechtigten 26.53 – 26.59
bb) Insolvenz des Schuldners 26.60
b) Anfechtungsgegner 26.61 – 26.67
aa) Einzelrechtsnachfolger des Dritten 26.62 – 26.66
bb) Mehrheit von Verpflichteten 26.67
2. Der Inhalt des Rückgewähranspruchs 26.68 – 26.78
a) Grundsatz 26.68 – 26.70
b) Rückgewähr in Natur 26.71 – 26.73
c) Wertersatz in Geld 26.74 – 26.76
d) Gegenrechte des Empfängers 26.77, 26.78
3. Die Geltendmachung der Anfechtung 26.79 – 26.88
a) Klage 26.80, 26.81
b) Einrede 26.82, 26.83
c) Anfechtungsankündigung 26.84
d) Behördlicher Duldungsbescheid 26.85
e) Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes 26.86 – 26.88
Fünftes Kapitel Die einzelnen Arten der Zwangsvollstreckung
Erster Abschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen
Vorbemerkungen
I. Geldforderungen in fremder Währung
II. Haftungsansprüche
III. Zahlungen an Dritte und Befreiungsanspruch
IV. Zwangsvollstreckung einer Wahlschuld
1. Unterabschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das bewegliche Vermögen
§ 27 Pfändung und Pfändungspfandrecht
I. Pfändung und Verstrickung 27.1 – 27.6
1. Begriffe und Funktion 27.2
2. Entstehung und Beendigung der Verstrickung 27.3 – 27.5
a) Entstehung 27.3
b) Beendigung 27.4, 27.5
3. Überpfändung, überflüssige Pfändung, Nachpfändung 27.6
II. Das Pfändungspfandrecht 27.7 – 27.11
1. Gesetzliche Regelung und ihre Streitfragen 27.7
2. Öffentlichrechtliche und privatrechtliche Theorie 27.8 – 27.10
a) Grundpositionen 27.8
b) Schwächen der öffentlichrechtlichen Theorie 27.9
c) Schwächen der privatrechtlichen Theorie 27.10
3. Die „gemischt privat-öffentlichrechtliche Theorie“ 27.11
III. Der Inhalt der gemischt privat-öffentlichrechtlichen Theorie 27.12 – 27.16
1. Die Bedeutung der Verstrickung für das Pfändungspfandrecht 27.12
2. Verstrickung ohne Pfändungspfandrecht 27.13, 27.14
a) Wesentliche Verfahrensfehler 27.13
b) Fehlen materiellrechtlicher Voraussetzungen 27.14
3. Akzessorietät des Pfändungspfandrechtes 27.15
4. Rechte des Inhabers eines Pfändungspfandrechtes 27.16
Начислим
+410
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе